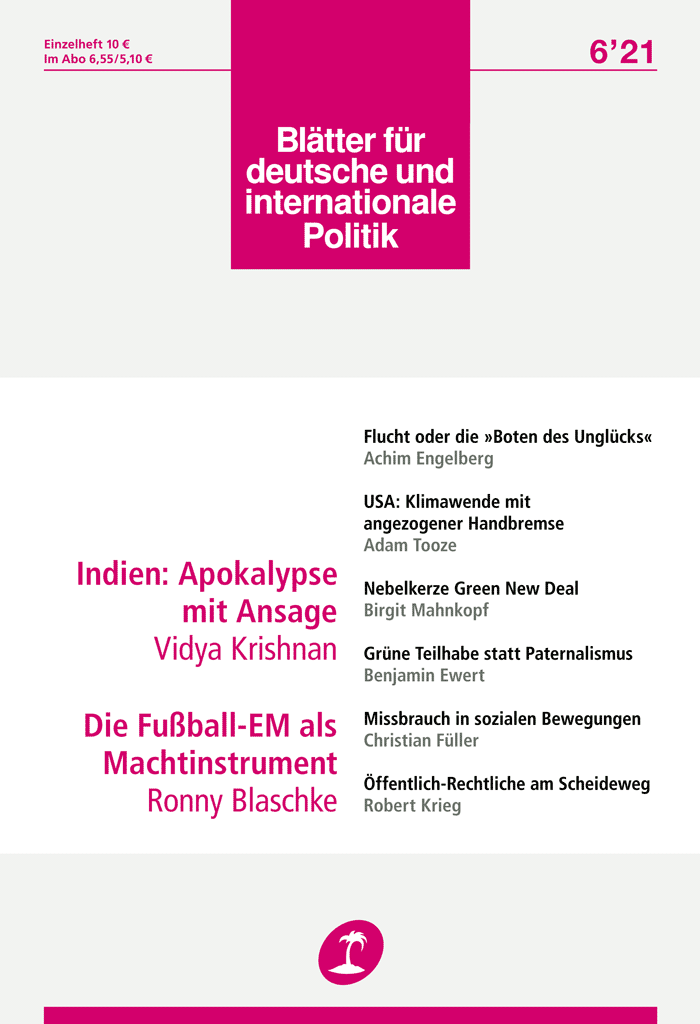Bild: Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer, 23. April 2021 (IMAGO / ULMER Pressebildagentur)
Am 8. Mai 2021 war das Maß endgültig voll: Die baden-württembergischen Grünen beschlossen im Rahmen eines Parteitags, in dessen Fokus eigentlich der soeben mit der CDU ausgehandelte Koalitionsvertrag stehen sollte, ein Ausschlussverfahren gegen den Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer einzuleiten. Sein letzter „Coup“ bestand in der Kombination von Sexismus und Rassismus in Bezug auf ein unbelegtes Zitat eines Fußballspielers. Das verwendete Vokabular braucht hier nicht reproduziert zu werden, es war schlicht unterirdisch – und wer es noch nicht kennen sollte, wird problemlos im Internet fündig. Entsprechend groß war der Groll im Saal. Per Liveschalte erklärte Palmer, sein Facebook-Post sei ironisch zu verstehen, die Partei brauche ihn, gerade jetzt, wo ein Klima der persönlichen Einschüchterung die offene Debatte zu ersticken drohe. Doch das überzeugte niemanden mehr – weder im Publikum noch in der grünen Parteiführung, die sich entschieden von Palmer distanzierte.
Man könnte versucht sein, diesen Vorgang lediglich als die unvermeidliche Folge einer skurrilen schwäbischen Renitenz oder einer narzisstischen Aufmerksamkeitssucht zu sehen. Hat ein Oberbürgermeister denn nichts Besseres zu tun, als regelmäßig auf Facebook die Vorgänge in der Welt in tabubrecherischer Manier zu bewerten? Aber der Fall Palmer hat womöglich doch paradigmatischen Charakter.