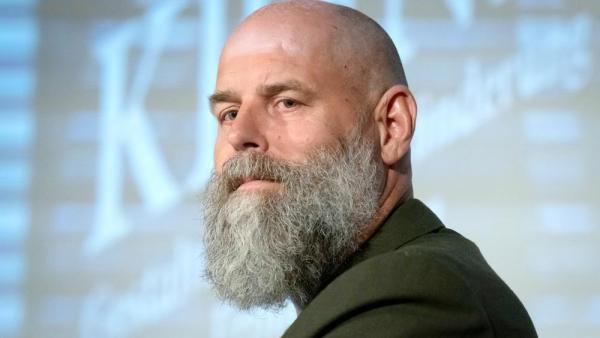Der antipolitische Populismus der Cultural Studies
In den letzten fünfzehn Jahren ist vor allem, aber nicht allein in der englisch-sprachigen Welt die Zahl derjenigen enorm gewachsen, die das Fach "Cultural Studies" betreiben und sich damit identifizieren. Mit Energie wird ans Werk gegangen, es herrschen Überzeugung, Elan und Leidenschaft. Möglich war dies nur, weil "Cultural Studies" eine Form des intellektuellen Lebens bieten, die auf von außerhalb hineingetragene Leidenschaften und Hoffnungen zu antworten weiß. Das Fach reagiert auf die Energien sozialer und kultureller Bewegungen - und auf ihren Niedergang. Die Cultural Studies sind nicht bereits völlig fertig ihrem Studienobjekt, der Kultur, entsprungen. Zu einem bedeutenden Teil entstand dieses Fach, weil der Gegenstand seiner Aufmerksamkeit wuchs: der Boom der Populärkultur (popular culture) und ihrer Bedeutung für das Leben in den westlichen Gesellschaften, besonders seit den 60er Jahren. Es bedarf keines ökonomischen Determinismus', um folgende Feststellung zu vertreten: Eine Vorbedingung für das Wachstum des Jugendmarktes war der Wirtschaftsaufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg und der starke Zuwachs des verfügbaren Einkommens bei den Jugendlichen der privilegierten Länder. Auch der säkulare Niedergang der Arbeit und das Aufkommen von "Freizeit", wie man sie nannte, trug zur zunehmenden Bedeutung der Populärkultur bei.