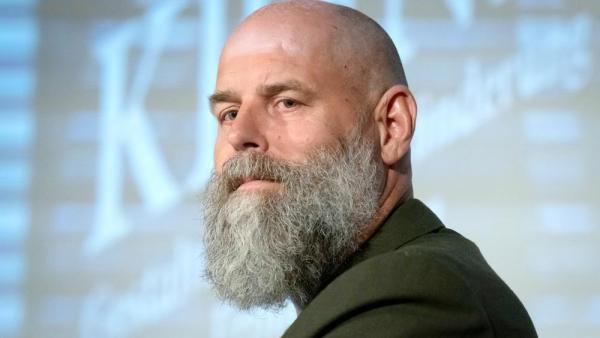Um das Internet ranken sich eine Reihe von teilweise recht weitreichenden ökonomischen und sozialen Verheißungen. Visionen von neuen Formen selbstbestimmter Arbeit in Unternehmen mit ausgesprochen flachen Hierarchien zählen ebenso dazu wie die Vorstellung, daß mit dem Siegeszug des Internet nahezu jedes in seinem Umfeld neugegründete Unternehmen, sei es auch noch so klein, eine reelle ökonomische Chance habe und daß diese neuen Firmen den etablierten Medien-, Handels- und Industriekonzernen der Old Economy den Rang ablaufen könnten. Was ist an allem dran? Steht eine Ablösung der Old Economy durch die - grausend möchte man sich von der Wortschöpfung abwenden - dot.coms bevor? Gibt es Anzeichen für tiefgreifende Restrukturierungen des Unternehmenssektors im Zuge der ökonomischen Aneignung des Internet? Die Euphorie rund ums Internet wurde bis zum Frühjahr 2000 maßgeblich von drei Entwicklungen gespeist: Erstens ist der kommerzielle Höhenflug des Netzes in der Tat von neugegründeten Firmen getragen worden. Die etablierten Medien-, Handels- und Industriekonzerne hatten die ökonomischen Möglichkeiten und Perspektiven des Internet, des E-commerce und des E-business, also des Internet-Einzelhandels und des Internet-Handels zwischen Unternehmen, zunächst nicht im Blick und unterschätzt.
In der Januar-Ausgabe skizziert der Journalist David Brooks, wie die so dringend nötige Massenbewegung gegen den Trumpismus entstehen könnte. Der Politikwissenschaftler Philipp Lepenies erörtert, ob die Demokratie in den USA in ihrem 250. Jubiläumsjahr noch gesichert ist – und wie sie in Deutschland geschützt werden kann. Der Politikwissenschaftler Sven Altenburger beleuchtet die aktuelle Debatte um die Wehrpflicht – und deren bürgerlich-demokratische Grundlagen. Der Sinologe Lucas Brang analysiert Pekings neue Friedensdiplomatie und erörtert, welche Antwort Europa darauf finden sollte. Die Journalistinnen Susanne Götze und Annika Joeres erläutern, warum die Abhängigkeit von Öl und Gas Europas Sicherheit gefährdet und wie wir ihr entkommen. Der Medienwissenschaftler Roberto Simanowski erklärt, wie wir im Umgang mit Künstlicher Intelligenz unsere Fähigkeit zum kritischen Denken bewahren können. Und die Soziologin Judith Kohlenberger plädiert für eine »Politik der Empathie« – als ein Schlüssel zur Bekämpfung autoritärer, illiberaler Tendenzen in unserer Gesellschaft.