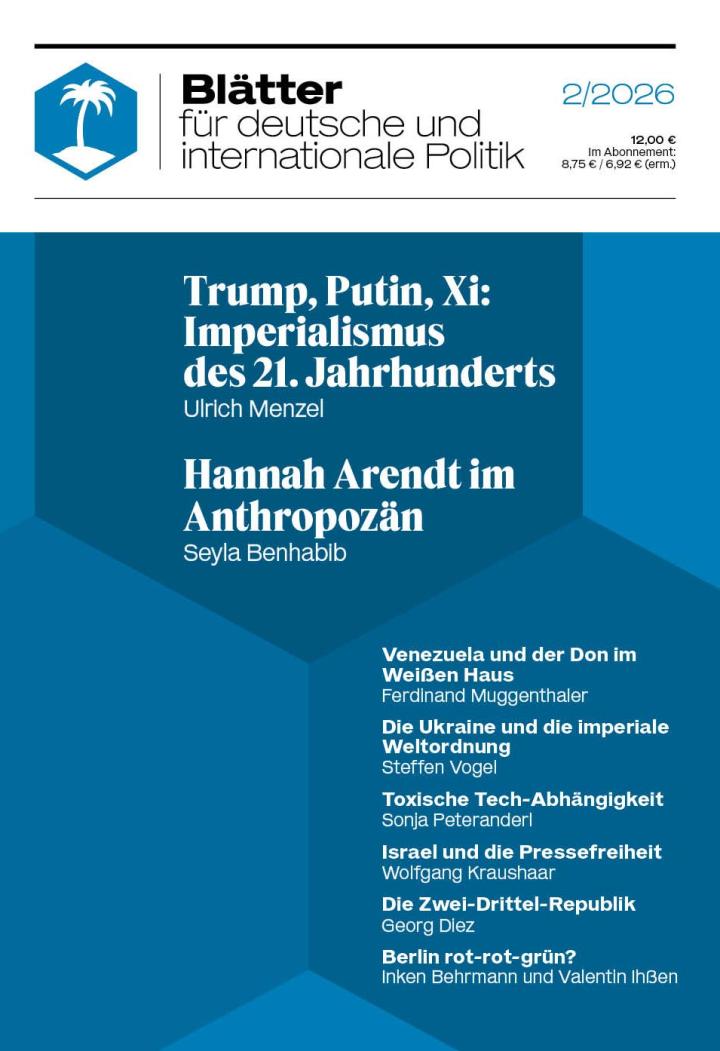Wie John McCain sich die amerikanische Außenpolitik vorstellt
Die Geschichte, wie George W. Bushs Regierungszeit die US-Republikaner politisch ruinierte, hat viele Seiten, doch kein Kapitel sticht so hervor wie sein Irakkrieg. Im gleichen Maße, wie die Besetzung des Zweistromlandes sich hinzog und die amerikanischen Verluste stiegen, sah Bush seine Umfragewerte dahinschwinden. Als schließlich die diesjährigen Primaries anstanden, sagten selbst unter den republikanischen Kandidaten viele, dass sie den Krieg im Irak mehr oder weniger nachdrücklich ablehnten.
Unter diesen Umständen überrascht es nicht, dass die GOP, die Grand Old Party, sich anschickt, einen Präsidentschaftskandidaten zu nominieren, der ihrer vom Krieg enttäuschten Basis gefällt. Was jedoch überrascht, ist die Tatsache, dass dieser Kandidat John McCain heißt.
Im Februar sah es für die Republikaner düster aus, und es lag auf der Hand, dass nur ein Kandidat, der auch Kriegsgegner auf seine Seite ziehen konnte, irgendeine Chance bot, dem Kandidaten der Demokraten Paroli zu bieten. Also löste es bei den Republikanern, so sehr der konservative Teil ihrer Basis sich auch geärgert haben mag, Glücksgefühle aus, als McCain den Favoriten der Bush-Anhänger, Mitt Romney, aus dem Feld schlug. Es gibt allerdings ein Problem.