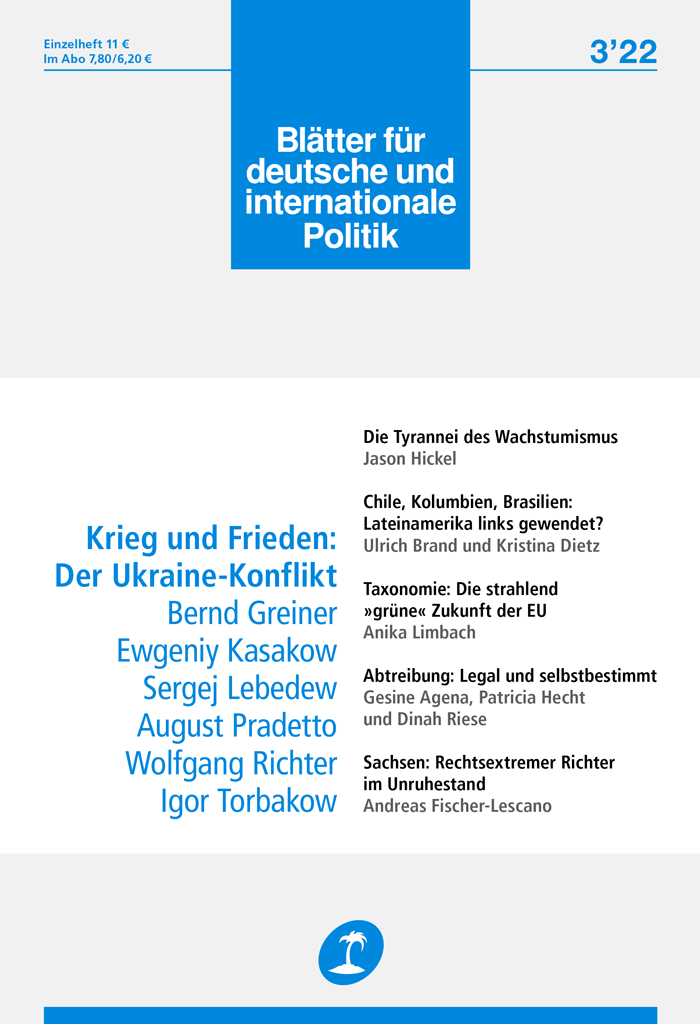Bild: Protest gegen das Wiederanfahren des Kernreaktors im zentraljapanischen Mihama in der Präfektur Fukui / Japan, 23.6.2021 (IMAGO / Kyodo News)
Derzeit erlebt nicht nur die Atomkraft, sondern auch die atomare Rüstung eine Renaissance – den bisherigen Atomkatastrophen sowie der verheerenden Zerstörungskraft atomarer Bomben zum Trotz.[1] Vor diesem Hintergrund findet die erste Überprüfungskonferenz des UN-Vertrags zum Verbot von Atomwaffen (VVA) vom 22. bis 24. März in Wien statt, wo die Unterzeichnerstaaten weitere Schritte zur Implementierung des Vertrags beraten wollen. Im Gedenken an die Zerstörung Hiroshimas und Nagasakis wie auch des Reaktorunfalls in Fukushima vor genau elf Jahren betrachtet die japanische Anti-Atom-Bewegung den Vertrag als Schritt in die richtige Richtung in einer Welt, in der viele Entscheidungsträger angesichts von Klimawandel und zunehmender Polarisierung Atomkraft für unverzichtbar halten.
Der 2017 ausgehandelte und von der UN-Vollversammlung mit großer Mehrheit verabschiedete Vertrag trat am 22. Januar 2021 in Kraft, als ihn 51 der 122 Unterzeichnerstaaten ratifiziert hatten. Aus Sicht der Initiatoren stellt er einen ersten Schritt hin zu einer atomwaffenfreien Welt dar. Der VVA verbietet nicht nur den Einsatz von Atomwaffen, sondern auch deren Entwicklung sowie das Testen und den Besitz derselben. António Guterres, der UN-Generalsekretär, begrüßte ihn als würdige Fortsetzung des Vertrags über die Nichtweiterverbreitung von Atomwaffen (NVV) aus dem Jahr 1970.