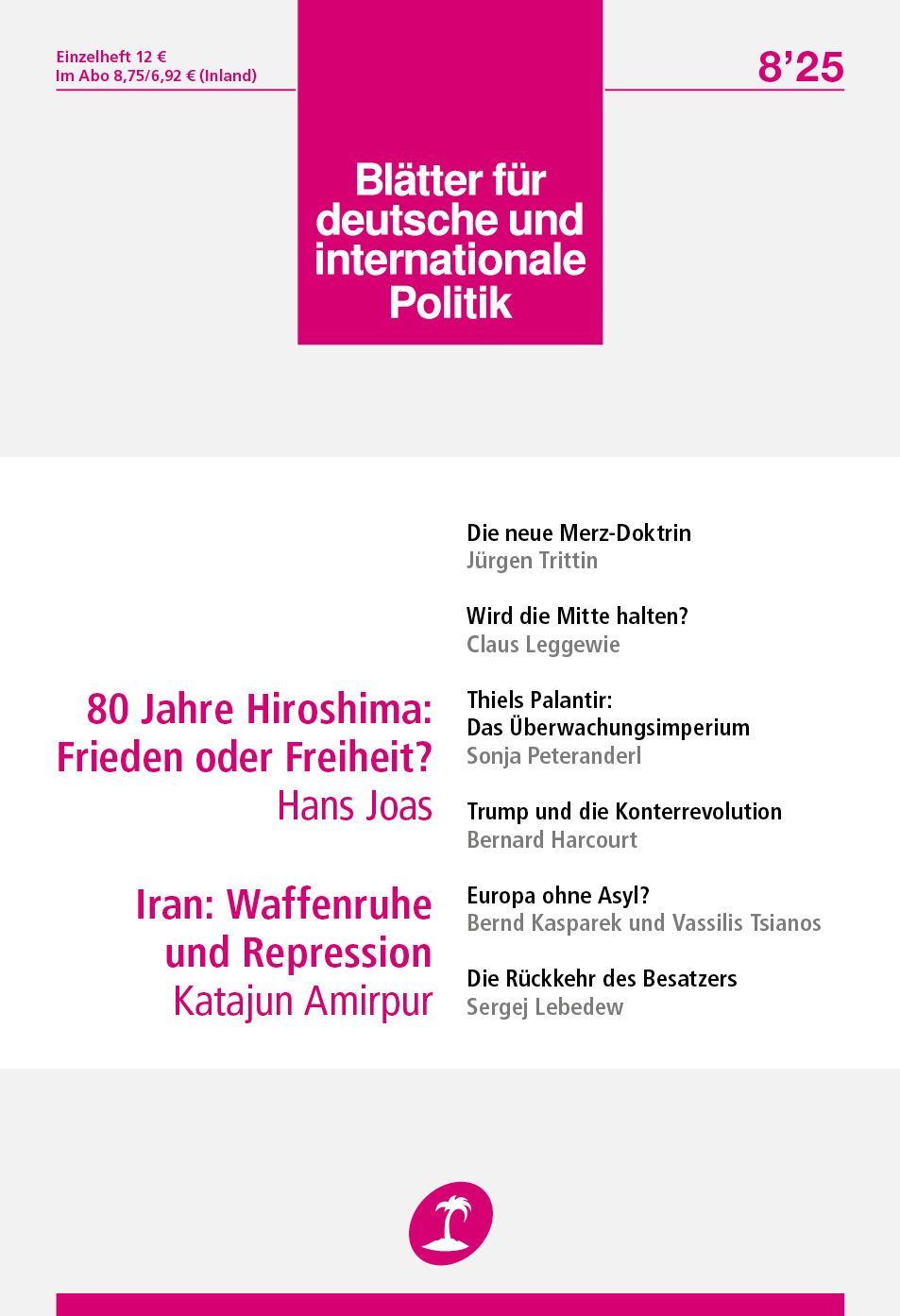Bild: Ein Mädchen am Flughafen Kabul, 7.11.2024 (IMAGO / Funke Foto Services)
Vier Jahre ist es her, dass Afghanistan den radikal-islamistischen Taliban kampflos überlassen wurde: Die neuen Herrscher gelangten nicht aus eigener Anstrengung an die Macht, diese wurde ihnen vielmehr auf einem silbernen Tablett serviert, das der Westen selbst gereicht hatte. Es sind vier Jahre, die für die Menschen in Afghanistan, allen voran für Frauen und Minderheiten, wie Jahrzehnte vergangen sind. Wollte sich anfangs kaum jemand ausmalen, wie es wäre, wenn die Taliban wohl länger als ein Jahr an der Macht bleiben würden, sind sie heute, im August 2025, so stark wie nie und ihre Macht ist fest zementiert. Die bittere Wahrheit ist: Der Traum von einem demokratischen Afghanistan ist vorbei – und mit ihm wurde auch der moralische Anspruch des Westens, ein solches zu schaffen, beerdigt.
In 20 Jahren Afghanistaneinsatz wurde das Land zu einem Brennglas, zu einem Sinnbild für westliche Doppelmoral, für globale Machtverschiebungen, für den bequemen Verrat an den Menschenrechten, den wir heute fast schon als gegeben anerkennen. Dabei sind mit „dem Westen“ vor allem jene Staaten gemeint, die sich über Jahrzehnte als Verteidiger einer liberalen, regelbasierten Ordnung verstanden haben: Deutschland, die USA, Großbritannien, Kanada, also die Hauptakteure der westlichen Militärinterven-tion in Afghanistan. Doch der Begriff des „Westens“ verliert zunehmend an Klarheit. Denn wenn selbst in den USA, einst dessen Führungsmacht, demokratische Prinzipien unter Druck geraten und der Rückzug aus multilateralen Institutionen zur politischen Strategie wird, dann ist klar: Auch das Selbstverständnis des Westens steht zur Disposition. Der Abzug aus Afghanistan offenbart die Doppelmoral einer internationalen Ordnung, die Menschenrechte predigt, sie aber dem innenpolitischen Kalkül opfert, wenn dies opportun erscheint. Das Ereignis war damit weit mehr als ein sicherheitspolitisches Desaster, es war der Offenbarungseid westlicher Prinzipien.
Ein Land in der Dauerkrise
Seit der Rückkehr der Taliban hat sich Afghanistan politisch, ökonomisch und gesellschaftlich in eine autoritär geführte Isolation begeben. Was 20 Jahre lang unter dem Banner des Demokratieexports aufgebaut worden war, zerbrach binnen weniger Wochen.Heute regiert keine demokratisch legitimierte Regierung, sondern ein theokratisches Emirat, das seine Macht zentralisiert, jeden Widerspruch brutal unterdrückt und jede noch so kleine Errungenschaft der vergangenen Jahrzehnte ausgelöscht hat. Afghanistan wird per Dekret regiert; politische Partizipation ist für Minderheiten nicht mehr möglich. Eine Verfassung existiert nicht, Parteien und unabhängige Medien wurden zerschlagen und werden zensiert, Menschenrechtsverletzungen wie Folter und willkürliche Inhaftierungen sind Alltag geworden.
Zugleich ist die humanitäre Lage dramatisch. Das Land ist von Hungersnot und Armut bedroht. Laut UN sind dieses Jahr fast 23 Millionen Menschen, etwa die Hälfte der Bevölkerung, auf humanitäre Unterstützung angewiesen. In vielen Provinzen fehlt es an medizinischer Grundversorgung, sauberem Trinkwasser und Nahrungsmitteln. Gleichzeitig verschärft sich die humanitäre Katastrophe durch massenhafte Abschiebungen von Afghaninnen und Afghanen aus den Nachbarländern Iran und Pakistan. Allein seit Anfang des Jahres haben laut Vereinten Nationen beide Länder mehr als 1,5 Millionen Menschen gewaltsam nach Afghanistan zurückgeschickt, viele von ihnen lebten bereits seit Jahrzehnten im Exil.[1] Pakistan und Iran begründen die Abschiebungen mit wirtschaftlichen Belastungen und sicherheitspolitischen Erwägungen. In Wahrheit dienen sie jedoch zunehmend als innenpolitisches Druckventil und außenpolitisches Instrument. Nach dem Zwölf-Tage-Krieg zwischen Israel und Iran sowie dem Konflikt zwischen Pakistan und Indien hat sich die Lage noch einmal dramatisch zugespitzt. Allein im Juni mussten über 600 000 Menschen den Iran verlassen. Afghanische Menschen werden in Iran der Spionage für Israel bezichtigt. Die Taliban haben jedoch weder die Ressourcen noch den Willen, diese entwurzelten Menschen zu unterstützen. Vielmehr verschärfen diese Zwangsrückführungen die soziale Krise und schaffen eine entwurzelte, perspektivlose Masse, deren Leid unter der Talibanherrschaft notgedrungen still bleibt.
Auch wirtschaftlich sind die Folgen des Machtwechsels vor vier Jahren katastrophal. Afghanistan gehört weiterhin zu den ärmsten Ländern der Welt. Die Wirtschaft ist abhängig von internationalen Hilfsgeldern. Nur sehr langsam scheint sich eine leichte Erholung einzustellen. Diese basiert vor allem auf der Rückkehr lokaler Märkte und begrenzten Handelsbeziehungen mit Nachbarstaaten wie China, Iran, Pakistan und zentralasiatischen Ländern. Für die breite Bevölkerung bleibt das jedoch folgenlos. Die Sanktionen des Westens und das Einfrieren der Gelder der afghanischen Zentralbank tun ein Übriges. Im Land fehlen Investitionen, Arbeitsplätze und Perspektiven. Wer die Chance zur Flucht hat, nimmt sie wahr – zurück bleiben jene, die zu arm oder zu schwach sind, um das Land zu verlassen. Mit der Machtübernahme der Taliban 2021 wurde in Afghanistan nicht einfach nur die Zeit zurückgedreht. Das Land wurde in eine autoritäre Realität zurückgeworfen, die der Westen durch seine kolonial gefärbte Ignoranz mit herbeigeführt hat und nun schulterzuckend toleriert.
Afghanische Geschlechterapartheid
Die jahrelange Propagierung von Menschen- und insbesondere Frauenrechten wirkt im Rückblick zynisch. Lange Zeit wurde die „Rettung“ afghanischer Frauen und queerer Menschen propagandistisch genutzt, um Militäreinsätze und Milliardeninvestitionen zu rechtfertigen. Als das Projekt „Demokratisierung Afghanistans“ scheiterte, wurden dieselben Menschen, in deren Namen man zuvor intervenierte, bedenkenlos geopfert. Heute zahlen sie den höchsten Preis für den strategischen Rückzug, den der Westen verantwortet.
Denn die Taliban diskriminieren Frauen systematisch. Die Vereinten Nationen sowie afghanische und internationale Aktivistinnen bezeichnen ihre Regierungsführung mittlerweile offen als Geschlechterapartheid, deren Folgen verheerend sind. Mädchen dürfen seit März 2022 nicht mehr zur Schule gehen. Universitäten sind Frauen verschlossen, genauso wie die meisten Arbeitsplätze. Frauen, die zuvor Professorinnen oder Richterinnen waren, sind heute unsichtbar. Sie wurden in private Räume zurückgedrängt, wirtschaftlich abhängig gemacht und existenziell bedroht. Wer sich widersetzt, protestiert oder nur den Wunsch nach Bildung äußert, riskiert Gefängnis, Folter oder Schlimmeres. Die mutigen Proteste von Frauen auf den Straßen Kabuls in den ersten Monaten nach der Machtübernahme wurden durch massive Gewalt niedergeschlagen. Heute regiert Angst das Leben der Afghaninnen. Angst vor Gewalt, Verfolgung und vor einer Zukunft ohne Hoffnung.
Diese systematische Unterdrückung führte nun erstmals auch auf internationaler Ebene zu Konsequenzen: Am 8. Juli erließ der Internationale Strafgerichtshof (IGH) Haftbefehle gegen den Talibanführer Haibatullah Akhundzada und den obersten Richter Afghanistans, Abdul Hakim Haqqani.[2] Der Vorwurf lautet Verbrechen gegen die Menschlichkeit, konkret geht es um die systematische und genderbasierte Verfolgung afghanischer Frauen und Mädchen. Damit erkennt das höchste internationale Gericht zum ersten Mal explizit an, dass geschlechtsspezifische Unterdrückung in Afghanistan ein Verbrechen von globaler Bedeutung ist. Doch für die afghanischen Frauen bleibt es vorerst eine symbolische Geste, da die Taliban die Zuständigkeit des IGH nicht anerkennen. Gleichzeitig erinnert diese Anklage den Westen daran, dass moralische Verantwortung nicht an Landesgrenzen enden darf, auch wenn er genau das seit vier Jahren ignoriert.
Die Situation queerer Afghaninnen und Afghanen bleibt unterdessen ebenfalls dramatisch: Für sie bedeutet das Talibanregime nicht nur Diskriminierung, sondern auch absolute Lebensgefahr. Homosexualität gilt als schweres Verbrechen, für das Haftstrafen, öffentliche Demütigungen oder sogar die Todesstrafe drohen. Queere Menschen leben daher im Verborgenen, sie sind vogelfrei, rechtlos und verfolgt. Selbst die wenigen zivilgesellschaftlichen Räume für queere Menschen, die vor 2021 mühsam aufgebaut worden waren, sind zerschlagen worden. Das Schicksal queerer Menschen in Afghanistan ist kaum sichtbar, weder für die Welt noch für die afghanische Gesellschaft selbst. Frauen, Mädchen und queere Afghaninnen und Afghanen sind heute Opfer eines doppelt grausamen Spiels: der Taliban, die sie entrechten, und einer internationalen Gemeinschaft, die ihre Rechte jahrelang instrumentalisierte, nur um sie schließlich aufzugeben.
Kalter Verrat an den afghanischen Ortskräften
Die Reaktion der internationalen Gemeinschaft auf die Talibanherrschaft ist ambivalent. Die Vereinten Nationen liefern humanitäre Hilfe, während die westlichen Staaten ihre Beziehungen eingefroren haben. Dennoch finanzieren sie über Umwege den Machterhalt der Taliban. Denn humanitäre Hilfe wird vor Ort vielfach durch Talibannahe Strukturen verteilt oder kontrolliert. Auch die Tatsache, dass sich internationale Organisationen an die Auflagen der Taliban halten müssen, etwa bei der Auswahl von Personal und Projekten oder durch das Bereitstellen männlicher Aufpasser für Mitarbeiterinnen, trägt indirekt zur Festigung ihrer Macht bei. China, Russland, Iran und andere autoritäre Staaten haben dagegen kein Problem mit der neuen Ordnung. Im Gegenteil: Sie sichern sich Einfluss und Ressourcen.
Ein weiteres Zeichen der moralischen Erosion ist die selektive Justiz. Der Internationale Strafgerichtshof stellte 2021 unter dem Druck der USA die Ermittlungen zu Kriegsverbrechen westlicher Truppen in Afghanistan ein. Dass nun Talibanführer angeklagt werden, ist richtig, aber es reicht nicht. Eine Weltordnung, die nur die Verbrechen der Gegner verfolgt, verliert ihre Glaubwürdigkeit.
Besonders drastisch spiegelt sich der moralische Niedergang des Westens in der Afghanistanpolitik der Bundesregierung unter Friedrich Merz wider. Seit dem Amtsantritt der CDU-geführten Regierung ist Afghanistan zu einer politischen Randnotiz verkommen und bleibt lediglich ein unbequemes Erbe, das man am liebsten vergessen würde.
Am sichtbarsten zeigt sich dies am Umgang mit den ehemaligen Ortskräften der Bundeswehr und deutscher Organisationen. Trotz eindeutiger Zusagen stellte die Ampelregierung die Aufnahmeprogramme bereits im Jahr 2024 aus Kostengründen ein. Dabei waren ohnehin nur etwa 1100 Menschen über das Programm nach Deutschland gekommen, also viel weniger, als die ursprünglich geplanten 12 000 jährlich.[3] Tausende Menschen, die ihr Leben für die Zusammenarbeit mit Deutschland riskierten, lässt die Bundesregierung eiskalt im Stich. Sie bleiben zurück, verstecken sich vor den Taliban, kämpfen ums tägliche Überleben, während Berlin wegschaut. Über 2000 Afghaninnen und Afghanen mit festen Aufnahmezusagen sitzen derzeit in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad fest und hoffen verzweifelt auf ihre Evakuierung. Immerhin: Anfang Juli entschied das Verwaltungsgericht in Berlin im Fall einer afghanischen Juradozentin und ihrer Familie, dass sich die Bundesregierung an die gemachten Aufnahmezusagen halten muss.
Vorbei sind auch die Tage, an denen man noch versucht hat, den Schein diplomatischer Distanz gegenüber den neuen Herrschern in Kabul zu wahren. Der deutsche Innenminister Alexander Dobrindt möchte direkte Verbindungen zu den Taliban aufnehmen, um straffällige afghanische Geflüchtete leichter abschieben zu können. Dass man hierzu offen mit einer islamistisch-extremistischen Gruppe kooperiert, die offiziell nach wie vor als Terrororganisation gelistet ist, nimmt der Innenminister billigend in Kauf. Eine Vorgehensweise, die seit Jahren von der rechtsextremen AfD propagiert wird, wird nun eins zu eins übernommen.
Merz und seine Regierung betreiben eine zynische Realpolitik, die innenpolitische Ruhe höher gewichtet als moralische Verantwortung. Die Ignoranz gegenüber der humanitären Krise, der Ortskräfte und aller anderen Opfer des Talibanregimes offenbart, dass Deutschlands Haltung zu Afghanistan längst nicht mehr von Menschenrechten, sondern von reinen innenpolitischen Kalkülen bestimmt wird. Afghanistan ist nicht bloß ein weiteres Land, das im Chaos versunken ist. Afghanistan ist der Spiegel, in den der Westen nicht schauen möchte. Denn der Blick hinein offenbart eine Wahrheit, die man jahrelang ignoriert hat: Die moralische Autorität des Westens ist gebrochen.
Die Konsequenzen des moralischen Niedergangs westlicher Staaten reichen dabei weit über Afghanistan hinaus. Denn wenn westliche Regierungen mit islamistischen Extremisten verhandeln, wenn sie ihre Ortskräfte verraten und Frauen sowie queere Menschen einem Unrechtsregime überlassen, dann zerfällt auch ihr eigener Anspruch auf globale Führungsstärke. China, Russland, Iran und andere autoritäre Mächte beobachten diesen Zerfall genau und ziehen daraus ihre Schlüsse. Afghanistan war nie nur eine lokale Katastrophe. Es war der Wendepunkt, an dem der Westen seine eigene Erzählung von moralischer Überlegenheit selbst zu demontieren begann.
Was heute in Kabul geschieht, passiert morgen vielleicht anderswo. Afghanistan mag zwar viele Kilometer entfernt sein, die politischen Folgen sind es nicht. Es ist das Menetekel, an dem sich entscheidet, ob der Westen überhaupt noch glaubwürdig für Werte eintreten kann oder ob er endgültig bereit ist, diese preiszugeben.
[1] United Nations: Afghanistan Returnees Overview (as of 30 June 2025), unocha.org, 8.7.2025.
[2] International Criminal Court: Situation in Afghanistan: ICC Pre-Trial Chamber II issues arrest warrants for Haibatullah Akhundzada and Abdul Hakim Haqqani, icc-cpi.int, 8.7.2025.
[3] Schlechte Chancen für Afghanen, spiegel.de, 28.2.2025.