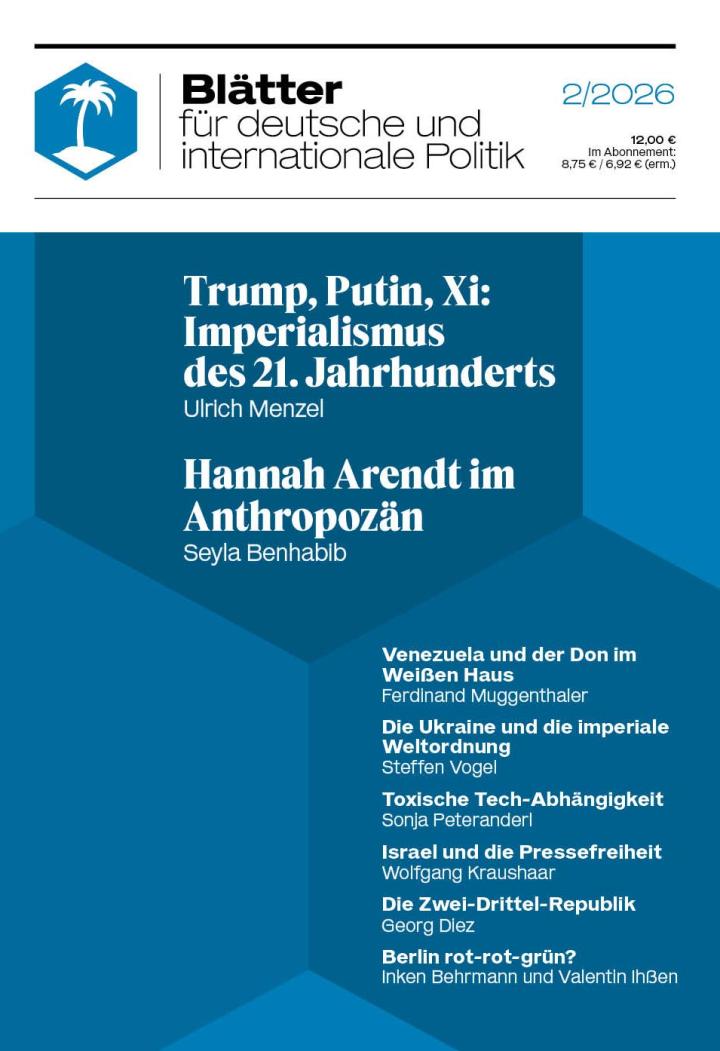Im Stimmengewirr deutscher Berichte über die US-Präsidentschaftswahlen ließ sich vor allem in linksliberalen Publikationen ein Motiv deutlich heraushören: Die Amerikaner, wie könnte man auch anderes von ihnen erwarten, hätten einmal mehr bewiesen, daß sie mit ihrem Konservatismus und ihren Rechtstendenzen nicht allzu weit vom Autoritarismus entfernt sind. Die Berichterstattung triefte vor Wunschdenken und einer Selbstprojektion, bei der wesentliche analytische Aspekte verlorengingen, die zentral sind für das Verständnis sowohl der Wahlresultate als auch des amerikanischen politischen Systems, um dessen ernsthafte Erläuterung sich jene deutschen Berichte nicht sonderlich kümmerten. Statt dessen jetteten die Journalisten, bestätigt in den Vorurteilen, mit denen sie aus Frankfurt oder Berlin angereist waren, jetzt mit dem großartigen Gefühl nach Hause zurück, daß die Welt komplett mit der vorgefaßten eigenen Meinung übereinstimmt.
Unbestreitbar ist, daß es häßliche Dinge in der gegenwärtigen amerikanischen Politik gibt. Man muß nur einen Blick auf den Fremdenhaß werfen, der in Staaten wie Kalifornien oder Florida grassiert (interessanterweise nicht in New York oder Texas) und der in Referenden mündet, die sich nicht nur gegen sogenannte illegale Einwanderer, sondern auch gegen diejenigen richtet, die völlig legal zugewandert sind.