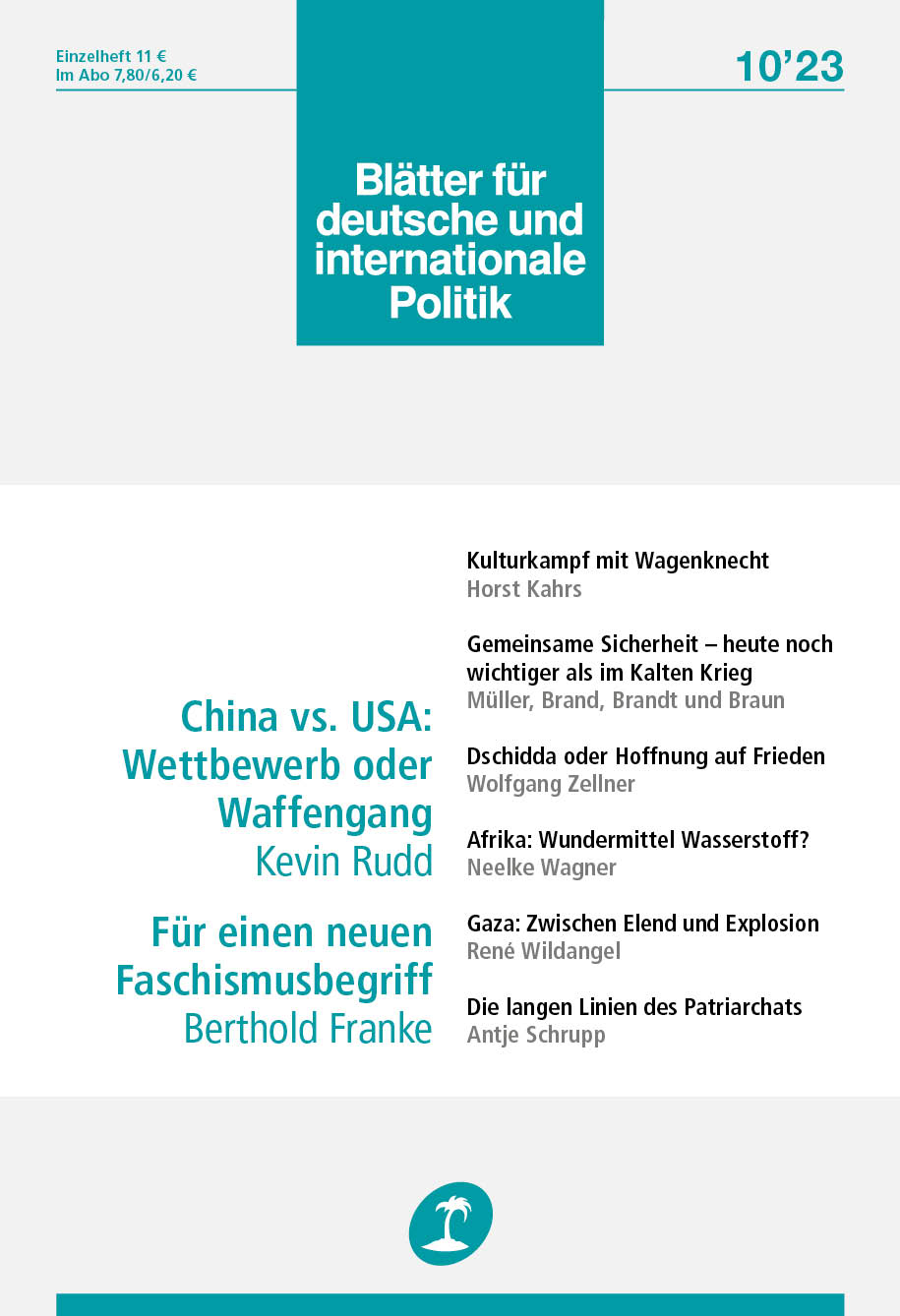Bild: Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze und der Außenminister von Mauretanien, Mohamed Salem Ould Merzoug in Nouakchott, 14.08.2023 (MAGO / photothek / Leon Kuegeler)
Kaum ein Staatsstreich in Afrika hat in den letzten Jahren in Politik und Medien derart viel Aufmerksamkeit erregt wie der Militärputsch in Niger am 26. Juli 2023.[1] Zwar sorgten auch die vorangegangenen militärischen Machtübernahmen in Mali[2] und Burkina Faso für Beunruhigung, vor allem wegen wachsender Feindseligkeit gegenüber den westlichen Staaten und des zunehmenden russischen Einflusses in diesen Ländern. Aber mit dem Machtwechsel in Niamey geht der EU nun der „Schlüsselpartner“ im Kampf gegen Dschihadismus und die sogenannte Schleuserkriminalität in der Region verloren. Noch ist es zu früh, verlässliche Aussagen über die zukünftige Politik der neuen Machthaber zu treffen, doch schon jetzt steht fest: Die westlichen Regierungen müssen sich in der Sahelregion völlig neu orientieren.
Nur 15 Tage vor dem Militärputsch in Niamey, am 10. Juli 2023, hatte Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) in der mauretanischen Hauptstadt Nouakchott die Präsidentschaft der Sahel-Allianz übernommen, einem 2017 von der EU, Frankreich und Deutschland gegründeten Bündnis mit der Mission, die Staaten der G5 Sahel – Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger und Tschad – im Kampf gegen die chronische Unsicherheit in der Region, die fehlenden wirtschaftlichen Perspektiven und die Folgen des Klimawandels zu unterstützen.