Der Paradigmenwechsel des Donald Trump und das Ende des Neoliberalismus
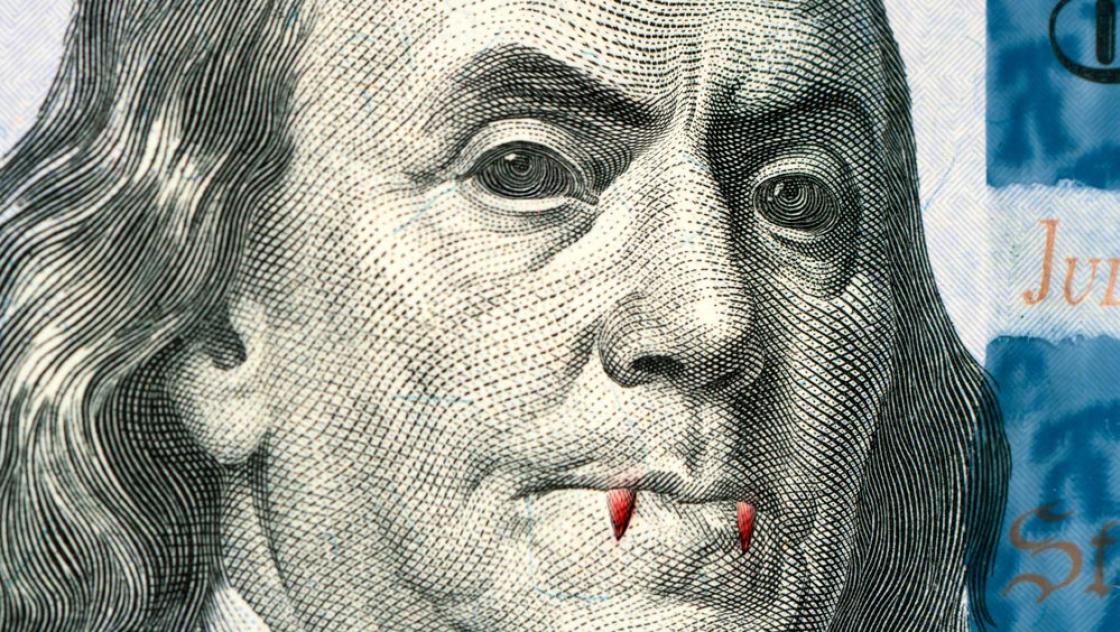
Bild: Benjamin Franklin als Vampir auf einem Hundert-Dollar-Schein (IMAGO / Pond5 Images)
Noch kein ganzes Jahr nach Beginn der zweiten Amtszeit von Donald Trump wird dessen Regierungsstil in aller Regel als „erratisch“ und weitgehend unberechenbar bezeichnet. Ähnlich skeptisch bis abfällig blickte man im alten Europa des Rheinischen Kapitalismus auf den Ex-Schauspieler Ronald Reagan, als dieser 1981 zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wurde – und übersah dabei doch die grundlegenden Veränderungen. Gemeinsam mit seiner Freundin im Geiste, Margret Thatcher, die zwei Jahre zuvor zur Premierministerin in Großbritannien avancierte, änderte Reagan das Gesicht des Kapitalismus. So setzte sich schließlich auch in Europa und der Bundesrepublik – beginnend mit der Regierungszeit Gerhard Schröders und Joschka Fischers – eine neue Form des Kapitalismus durch, die heute meist als neoliberal bezeichnet wird. Wissenschaftlicher formuliert: Das alte fordistische Akkumulationsmodell, das sozialstaatliche Absicherungen mit Massenproduktion und Massengesellschaft verband, wurde abgelöst vom Marktradikalismus. Die alte, jedenfalls teilweise auf Egalität basierende Massengesellschaft verflüchtigte sich, was als Individualisierung gefeiert wurde.[1] Doch es war eine Form der Atomisierung, die Thatcher mit dem bekannten Wort auf den Punkt brachte: „There is no such thing as society. There are individual men and women, and there are families, and no government can do anything except through people, and people must look to themselves first.









