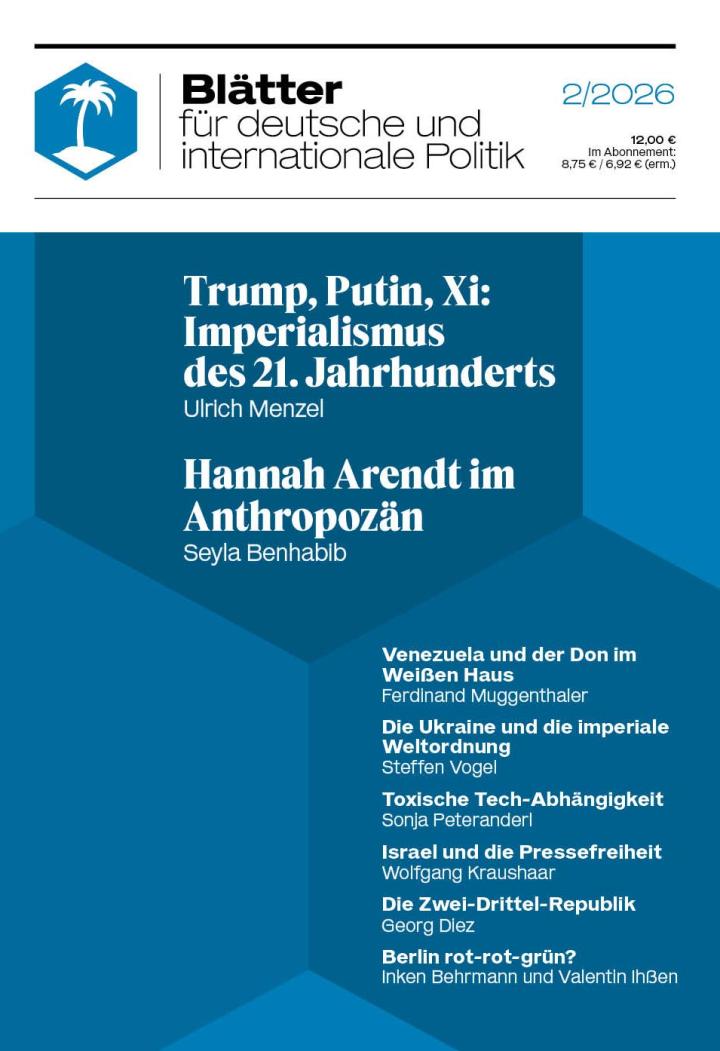Ein Provinztheater ist an und für sich etwas Trauriges. Mit den großen Bühnen, die per Fernsehen ins Haus geliefert werden, kann es nicht konkurrieren, finanziell nicht und künstlerisch nicht. Hohe Kultur unter Menschen zu bringen, die aber, wenn überhaupt, nur die Spitzenleistungen konsumieren, ist ein frustrierendes Geschäft. In der DDR war das anders, da hatten die kleinen Bühnen eine gewisse Attraktivität, ein lokalsolidarisches Publikum und einen kleinen Freiraum, politisch und sozial. Mit der "Wende" hat auch diese tendenzielle Idylle ihre Daseinsmöglichkeit verloren. Die sächsischen, thüringischen und vorpommerschen Bühnen fallen der Tristesse anheim: Existenzangst und Legitimationsverlust kommen über sie wie schleichender Schnee, nicht einmal aufs SichWehren sind sie vorbereitet.
Andreas Dresens Film Stilles Land zeigt diesen gegenwärtigen Prozeß, der uns hier im Westen wie ein geschichtlicher vorkommt. Ein junger Regisseur inszeniert Becketts Warten auf Godot auf der Bühne, die sonst Wilhelm Tell und seine Artgenossen bevölkern. Weit weg in Berlin und tief in den Menschen geht gleichzeitig etwas vor sich: draußen die friedliche Revolution, nur im ständig versagenden Fernseher präsent, und innen die sie begleitende Krise, die sich bei den Proben in ständig wechselnden Konzeptionen und Zornausbrüchen entlädt.