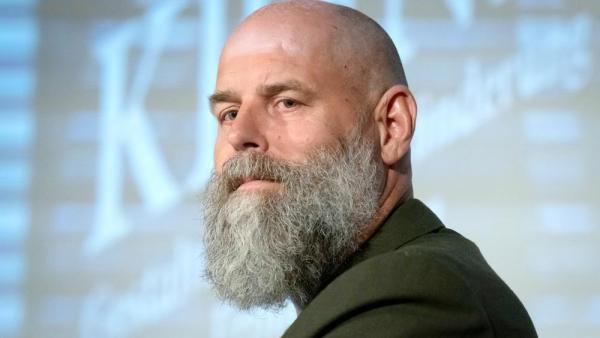Seit Monaten dasselbe Bild. Die Grünen sinken tief und tiefer in der Wählergunst und die Demoskopen verkünden voller Überraschung: "Trotz der schlechten Noten für die Grünen steht Außenminister Joschka Fischer ganz oben in der Beliebtheitsrangliste." Welcher Streit auch immer im grünen Hühnerhaufen tobt, eines ist gewiß: Joschka Fischer geht gestärkt daraus hervor. Die Medien sind begeistert. Ein Phänomen, dieser Mann! Dabei ist das Prinzip immer dasselbe. Fischers Aktien steigen nicht trotz, sondern wegen des grünen Desasters. Und auch die Dramaturgie verläuft stets nach dem gleichen Muster. Ein gramvoller Joschka Fischer nimmt den Kampf mit den Windmühlenflügeln seiner Partei auf. Seine Botschaft ist schlicht und lautet: Normale Partei werden, normale Strukturen. So bereits im März '99 in Erfurt, als der leidgeplagte Außenminister sich wieder einmal anschickte, es mit den unprofessionellen Parteistrukturen aufzunehmen. Und wieder war der grüne Kindergarten gar zu uneinsichtig. Joschkas Kurse stiegen, obwohl der Mißerfolg primär seiner eigenen Medienpolitik zuzuschreiben war. Und genauso hätte es am Wochenende der Sachsenwahl funktionieren können, als sich der "alte Jagdhund" (Fischer über Fischer) 1) einmal mehr an seine Sisyphus-Arbeit, genannt Parteireform, begab.
In der Februar-Ausgabe analysiert Ferdinand Muggenthaler die Folgen des US-Militärschlags in Venezuela für Lateinamerika – und erläutert, an welche Grenzen Trumps imperiale Ambitionen auf dem Subkontinent stoßen könnten. Nach vier Jahren russischer Vollinvasion und einem Jahr Trump ist die Ukraine zu einem zentralen Schauplatz im Ringen um eine imperiale globale Ordnung avanciert, argumentiert Steffen Vogel. Ulrich Menzel beschreibt die Konturen des heranbrechenden neuen imperialistischen Zeitalters, in dem das »Trio infernale« – USA, Russland und China – miteinander um die globale Vorherrschaft ringt. Seyla Benhabib beleuchtet unter Rückgriff auf das Denken Hannah Arendts die dramatischen Herausforderungen der Demokratie im planetarischen Zeitalter. Sonja Peteranderl zeigt auf, wie sich deutsche Behörden aus ihrer Abhängigkeit von Trump-hörigen Tech-Konzernen lösen können. Dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk hierzulande nicht nur innenpolitisch unter Druck steht, sondern auch ausländische Regierungen politisch Einfluss auszuüben versuchen, zeigt Wolfgang Kraushaar am Beispiel der Kontroverse um die ARD-Israel-Korrespondentin Sophie von der Tann. Und Georg Diez plädiert angesichts der wachsenden Stimmenanteile der AfD für die Abkehr von Parteidisziplin und den Umbau der Demokratie hin zu einer zielorientierten Zwei-Drittel-Republik.