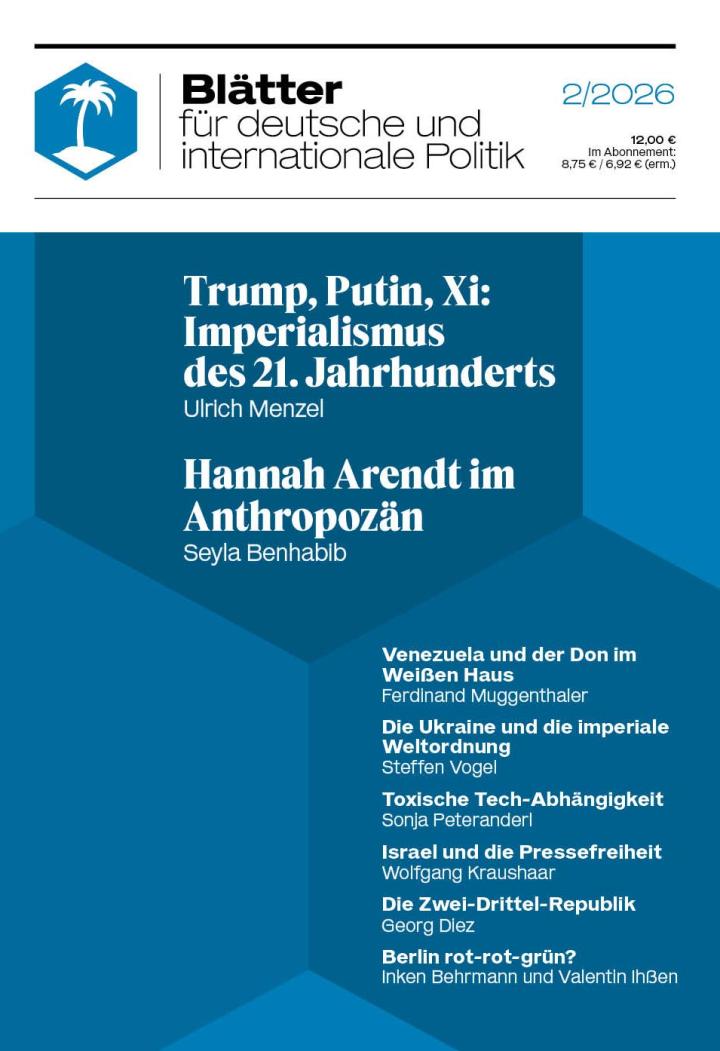Die "New York Times" hat Kolumbien einmal das "Bosnien Lateinamerikas" genannt. Hier tobt seit fast 40 Jahren ein blutiger, hinterhältiger Bürgerkrieg zwischen marxistisch-maoistischen Guerrilla-Einheiten, rechten Todesschwadronen, dem Militär und kriminellen Drogenkartellen: 30 000 Morde jährlich, sieben Entführungen täglich und rund zwei Millionen Flüchtlinge innerhalb der letzen zehn Jahre - die Hälfte von ihnen lebt im Exil in Nachbarstaaten. So lautet die nüchterne Zahlenbilanz des drittgrößten Landes Lateinamerikas. Neuerdings wird gar von einer "Vietnamisierung" gesprochen, da sich die Vereinigten Staaten immer engagierter in den internen Konflikt einmischen: mit viel Geld, mit Waffen, mit "Militärberatern" - sprich Soldaten. Seit der letzten Präsidentenwahl vor zwei Jahren versuchen die USA mit bisher einmaligen (Un-) Summen in erster Linie den Drogenanbau in dem Andenstaat auszutrocknen. Die Nachbarstaaten fürchten seither jedoch eine Ausweitung der "kolumbianischen Seuche" auf ihr Gebiet und eine militärische US-Intervention im großen Stil. Der gesamten Region droht eine Destabilisierung in bisher ungeahntem Ausmaß.
Worum es bei dem Bürgerkrieg geht, wissen selbst erfahrene Experten nicht mehr zu sagen. Nur eines ist klar: Das Land kennt kaum einen anderen Zustand.