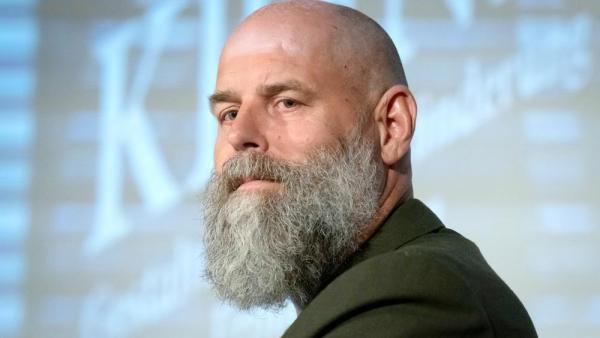Seit einer im Jahr 2004 vom kalifornischen Trendforscher Tim O’Reilly organisierten Konferenz ist das dort kreierte buzzword „Web 2.0“ in aller Munde – und soll signalisieren, dass nach dem Platzen der Dotcom-Blase Ende 2001 und dem abrupten Zusammenbruch des ersten Hypes in den vergangenen Jahren neue Bewegung in die Nutzung und Kommerzialisierung des Internet gekommen ist.
Das neue Logo ist – zieht man die naive Euphorie ab, die mit derartigen Begriffsbildungen immer einhergeht – keineswegs völlig substanzlos. In sozialer Hinsicht wird damit der Übergang von der lokalen Datenhaltung auf dem PC und der vornehmlichen Nutzung des Internet als Medium zur Informationsbeschaffung hin zur Auslagerung von persönlichen Profilen und Vorlieben, Tagebüchern, Bildern, Videos oder Textbeiträgen ins Netz betont. Die ausgelagerten Daten können dort nicht nur deponiert, sondern auch zusammengelegt, vernetzt, gezielt gesucht, kommentiert und bewertet werden. Ermöglicht werden derartige interaktive Angebote – dies ist der ökonomische Gehalt des Web 2.0 – durch neue, zumeist von einzelnen Personen gegründete Internetunternehmen, die entsprechende Dienste bereitstellen, sowie durch die bemerkenswerte Bereitschaft der überwiegend jugendlichen Nutzer, in großem Umfang persönliche Informationen freizugeben, die von jedem abgerufen werden können.
Dies sind längst keine Randerscheinungen mehr.