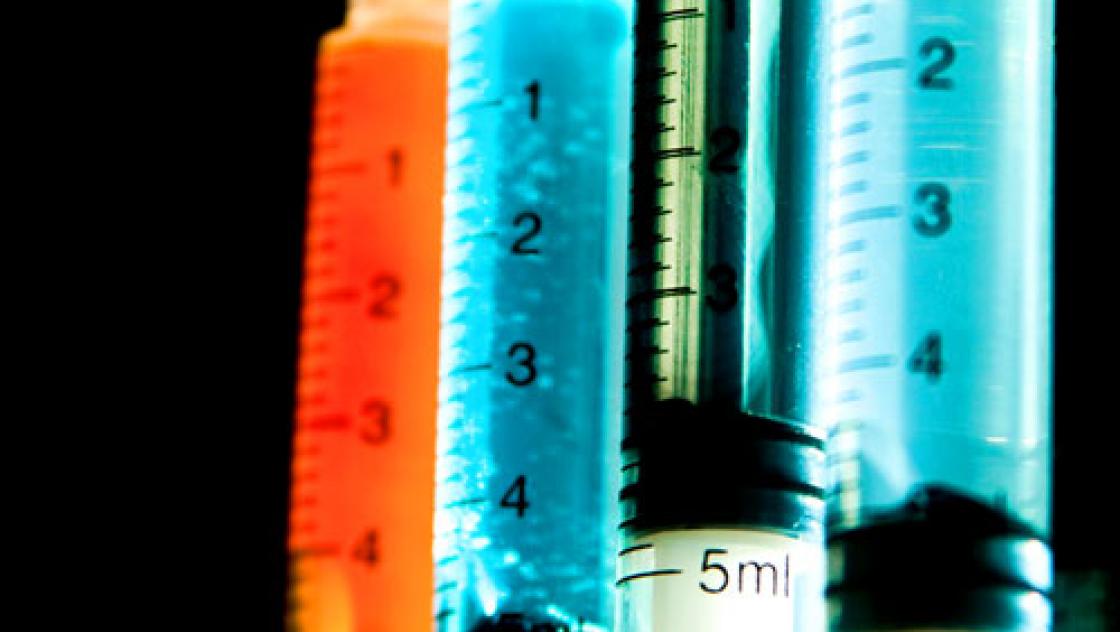PID bis Demenz: Erkundungen im biopolitischen Feld
Ein kleiner Zipfel Haut hat vor drei Monaten in der Republik ein regelrechtes diskursives Erdbeben ausgelöst. Keine Entscheidung in bioethischen Fragen hat so viel Unruhe provoziert wie das Urteil des Kölner Landgerichts zur Beschneidung. Im Kern geht es um die Gewichtung zweier Grundrechte: das Recht auf freie Religionsausübung der Eltern und das Recht auf körperliche Unversehrtheit des Kindes. Das Gericht hat dabei das Selbstbestimmungsrecht des Kindes höher gewertet als das Recht der Eltern, ihre Kinder in ihrem Glauben zu erziehen.[1]
Auch in vielen anderen Zusammenhängen ist Selbstbestimmung mittlerweile zu einem zentralen Leitbegriff in der diskursiven Kampfzone avanciert. Wer Selbstbestimmung einklagt, weiß das aufgeklärte Publikum zumeist auf seiner Seite; wer Entscheidungsrechte beschneiden will, macht sich der Bevormundung verdächtig.
Längst sind die Zeiten vorbei, als Frauen noch misstrauisch beäugt wurden, wenn sie für das Recht auf Abtreibung auf die Straße gingen und auf diese Weise die Unverfügbarkeit ihres Körpers reklamierten. Heutzutage trifft auf offene Ohren, wer darauf beharrt, selbst über sich, seinen Körper, sein Schicksal bestimmen zu wollen: Das gilt für Frauen ebenso wie für geschlechtlich nichtnormierte Menschen, für Menschen mit Behinderungen, Heiratswillige, halbwüchsige Scheidungskinder oder sterbenskranke Menschen.