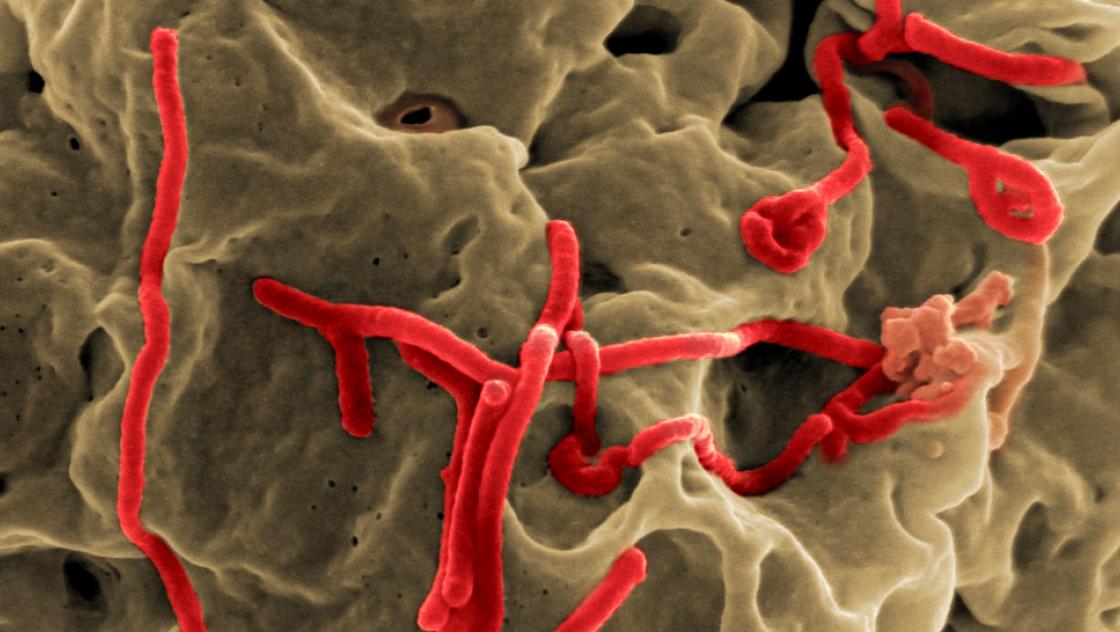Anfang September am Sitz der Weltgesundheitsorganisation WHO in Genf: 200 Mediziner treffen sich im größten Hotel der Schweiz, um über die Ebola-Medikamente der Zukunft zu diskutieren. Ein paar Tage zuvor ist WHO-Chefin Margaret Chan zu einem Ebola-Gipfel in die USA geflogen. Auch dort: Viele Gespräche, der UN-Generalsekretär ist sehr besorgt.
Unterdessen in Westafrika, da, wo die Seuche wütet: Ein an Ebola infizierter Mann flieht aus einem liberianischen Krankenhaus, weil es dort nichts zu essen gibt. Auf dem nahen Markt, wo er sich Lebensmittel besorgt, bricht Panik aus. In einem anderen Krankenhaus streiken die Pfleger. Die einzige Trage, auf der sie Kranke und Tote gleichermaßen transportiert haben, ist kaputt gegangen. Und der Staat schafft es nicht, den täglich von Ansteckung Bedrohten ihre Gehälter von 50 Dollar im Monat auszuzahlen. Schutzanzüge gibt es ohnehin kaum, hunderte Pfleger haben sich bereits infiziert.
Der Vergleich zwischen Liberia, wo die Menschen seit einem halben Jahr mit einem tödlichen Virus kämpfen, und den langsam anlaufenden Debatten in den Ebolaverwaltungszentralen dieser Welt zeigt, wie groß die Kluft zwischen Afrika und der entwickelten Welt inzwischen ist. Europäer scheinen sich tatsächlich nicht vorstellen zu können, was Liberianer, Sierraleoner und Guineer gerade durchmachen.