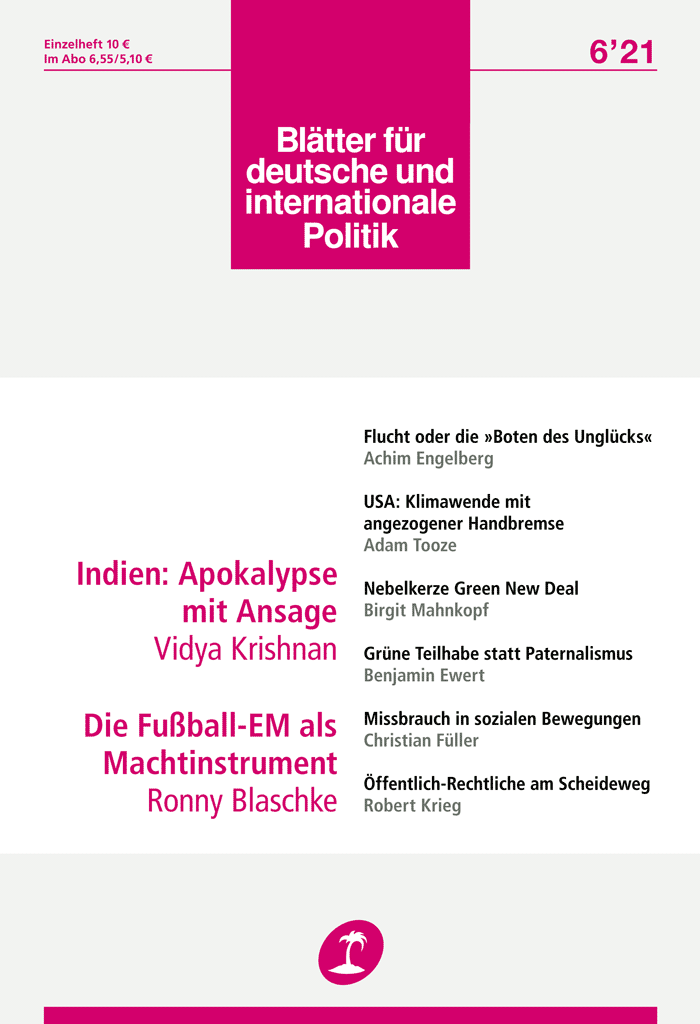Bild: Pablo Iglesias, Unidas-Podemos-Kandidat für die Regionalwahlen in Madrid und ehemaliger spanischer Vizepräsident, gibt nach den Regionalwahlen in Madrid seinen Rücktritt bekannt, 4. Mai 2021 (IMAGO / Agencia EFE)
Gebannt blickte ganz Spanien am 4. Mai auf die Wahlen in der spanischen Hauptstadtregion Madrid. Dass ihnen landesweite Bedeutung zukommen würde, galt bereits im Vorfeld als ausgemacht: Regionalpräsidentin Isabel Díaz Ayuso vom konservativen Partido Popular hatte die vorgezogenen Neuwahlen unter dem Slogan „Freiheit“ als Abrechnung mit der restriktiven Corona-Politik der Linkskoalition um den sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez inszeniert. Pablo Iglesias nahm die Herausforderung an, trat überraschend als stellvertretender Regierungschef zurück und ließ sich als Kandidat für das Linksbündnis Unidas Podemos (UP) aufstellen. Und der Wahlabend endete mit einem doppelten Paukenschlag: Díaz Ayusos Partei konnte ihr Ergebnis im Vergleich zu 2019 verdoppeln und erzielte mit 65 von insgesamt 136 Sitzen mehr als alle linken Parteien zusammen. Um bequem regieren zu können, reicht ihr die punktuelle Zusammenarbeit mit der rechtsextremen Vox, die dreizehn Abgeordnete stellt.
Für die zweite Schlagzeile sorgte Pablo Iglesias. Angesichts des mageren Ergebnisses trat der Podemos-Mitbegründer von allen Ämtern zurück und kündigte seinen Rückzug von der politischen Bühne an. Iglesias war es zwar gelungen, der schwächelnden Madrider UP mit 7,2 Prozent und zehn Abgeordneten über die Fünfprozenthürde zu helfen. Doch kam die Partei in einer ihrer Hochburgen nur auf den letzten Platz. Denn mehr noch als die eigene Anhängerschaft hatte die Überraschungskandidatur des prominenten Chefs das gegnerische Lager mobilisiert. „El Coletas“, wie Iglesias bisher wegen seines emblematischen Pferdeschwanzes von seinen Gegnern etwas abschätzig genannt wurde, polarisiert. Und das hat seiner Partei mehr geschadet als genutzt.
Dabei ging es weniger um Sachfragen oder Entscheidungen, für die Iglesias als ehemaliges Regierungsmitglied verantwortlich gemacht wurde, als um persönliche Aversionen. In einem, auch durch die Auftritte der ultrarechten Vox befeuerten, extrem aggressiven Wahlkampf wurde Iglesias zur Zielscheibe von Hassattacken: Er erhielt einen Briefumschlag mit scharfer Munition, weitere Morddrohungen an Politiker*innen folgten. „Ich bin der Sündenbock, der bei denjenigen, die die Demokratie zerstören wollen, die schlimmsten Eigenschaften weckt“, resümierte Iglesias in der Wahlnacht. „Ich trage nicht dazu bei, Kräfte zu vereinen.“
Das war ein kompromissloses Eingeständnis seiner Niederlage. Es frappiert umso mehr, da Pablo Iglesias vor noch nicht allzu langer Zeit als Hoffnungsträger der europäischen Linken gefeiert wurde. Der kometenhafte Aufstieg der 2014 von Iglesias und einem kleinen Kreis befreundeter Hochschuldozent*innen gegründeten Protestpartei Podemos verblüffte international. Die Organisation verstand es, das politische Potential der sogenannten Empörtenbewegung zu nutzen und damit Spaniens starre Parteienlandschaft aufzubrechen. Am 15. Mai 2011 hatten in Madrid junge Leute im Anschluss an eine Demonstration die Puerta del Sol besetzt, innerhalb weniger Tage schlossen sich ihnen Protestcamps im ganzen Land an. Spanien ächzte damals unter den Folgen der Finanzkrise. Bei prekären Beschäftigungsverhältnissen und einer Jugendarbeitslosigkeit von 40 Prozent sah sich vor allem die junge, gut ausgebildete Mittelschicht ihrer Zukunftsperspektiven beraubt. Die traditionellen Parteien hatten ihren Kredit verspielt. „Nein, sie repräsentieren uns nicht“, war das Motto der Stunde.
Mit dem Versprechen einer anderen Politik traf Podemos bei dieser Klientel einen Nerv. Man werde den „Himmel stürmen“, sagte Iglesias bei der Gründungsversammlung. So viel Selbstbewusstsein imponierte, der langhaarige Mann im Karohemd entwickelte sich zum Rockstar der spanischen Politik und war zeitweise der Politiker mit den höchsten Sympathiewerten.[1] Bei den Europawahlen 2014 erreichte die Partei aus dem Stand fünf Sitze. Als Podemos wenige Monate später bei den Parlamentswahlen kandidierte, machten mehr als drei Millionen Menschen ihr Kreuz bei den jungen Wilden. Mit seinem außergewöhnlichen rhetorischen Talent und der Fähigkeit, Massen zu begeistern, hatte Iglesias großen Anteil an diesem Erfolg.
Zwei Parlamentswahlen, die beide wiederholt werden mussten, und diverse erbitterte Machtkämpfe später nahm Pablo Iglesias tatsächlich auf der Regierungsbank Platz, als Teil der ersten Linkskoalition des modernen Spaniens. Das Verhältnis zwischen dem sozialdemokratischen PSOE und Unidas Podemos ist zwar nicht frei von Spannungen, aber mit der Erhöhung des Mindesteinkommens, einer Basisrente und einem Stopp von Zwangsräumungen während der Pandemie konnte die Linkspartei vor allem im Sozialen wichtige Impulse setzen. Die Bilanz ist ordentlich, das macht den Rückzug von Iglesias, nach nur einem knappen Jahr im Zentrum der Macht, erklärungsbedürftig. „Iglesias‘ eigentliche Leidenschaft war immer die politische Kommunikation, das parlamentarische Tagesgeschäft hat ihn nur zweitrangig interessiert“, sagt Aitor Riveiro, Journalist und Autor eines viel beachteten Buches über den Aufstieg der Partei.[2] Außerdem habe ihm die mediale Beobachtung, unter der er, seine Lebensgefährtin und Parteikollegin Irene Montero und die drei gemeinsamen Kinder standen, immer mehr zugesetzt. Über Wochen protestierten rechtsextreme Gruppen lautstark vor dem Privathaus der Politikerfamilie.
Wer folgt auf Pablo Iglesias?
Der Weggang des Chefs stellt seine Partei vor große Herausforderungen. Nicht nur in der Region Madrid, auch spanienweit verliert sie an Zuspruch: Gaben laut dem Meinungsforschungsinstitut CIS im Januar 2015 noch 24,5 Prozent der Spanier*innen an, ihr Kreuz bei Podemos machen zu wollen, waren es im April dieses Jahres nur noch 10,7 Prozent.[3] Ohnehin ist angesichts des polarisierten politischen Klimas in Spanien ein Machtwechsel an der Parteispitze alles andere als eine Routineangelegenheit. Im Fall von Podemos kommt noch ein strukturelles Problem hinzu: Die Organisation, die sich zunächst als Bewegung verstand, hat sich in kurzer Zeit zu einer streng hierarchischen Partei entwickelt. Und Iglesias‘ personenzentrierter Politikstil hat den Aufbau alternativer Führungspersönlichkeiten verhindert.
Um politischen Nachwuchs aus der eigenen Basis hat sich Podemos nicht ausreichend gekümmert. Das rächt sich nun. Zwar experimentierte man in der Gründungsphase – inspiriert von der Empörtenbewegung – mit basisdemokratischen „círculos“, in denen Sympathisant*innen politische Vorschläge einbringen und ausarbeiten sollten. Doch deren naturgemäß langsame Mechanismen fielen dem Dauerwahlkampf zum Opfer: Neben den Europa- und Parlamentswahlen trat Podemos, teils in Zusammenschlüssen mit lokalen Bündnissen, 2015 auch bei den Kommunalwahlen und mehreren Regionalwahlen an. In den strategischen Überlegungen räumte man dem Machtgewinn immer Priorität ein: Umfragewerte und Reaktionen auf Tweets und Postings hatten so größeren Einfluss auf das Programm als Ideen von der Basis.[4] Zwar wird bei Grundsatzentscheidungen weiter die Basis befragt, abgesehen davon unterscheiden sich die Entscheidungsfindungsprozesse bei Podemos nicht mehr wesentlich von denen traditioneller Parteien.
Das zeigt sich auch bei der Nachfolgeregelung, für die der Ex-Chef die Weichen stellte: Im Kabinett rückte als stellvertretende Regierungschefin und Koordinatorin der Unidas-Podemos-Minsterien Arbeitsministerin Yolanda Díaz nach. Die studierte Anwältin ist nicht Podemos-Mitglied, sondern gehört zur Izquierda Unida, die mit Podemos das Wahlbündnis Unidas Podemos bildet. Sie soll auch Spitzenkandidatin bei den nächsten Parlamentswahlen werden. Die Entscheidung darüber obliegt zwar der Basis: Doch dass Iglesias bei seinem Vorschlag auf eine Politikerin des Bündnispartners setzt, statt auf langjährige Weggefährtinnen, zeigt, wie dünn dort die Personaldecke ist. Durch zermürbende Machtkämpfe hat die Partei in ihrer kurzen Geschichte einen Großteil ihrer Gründungspersönlichkeiten verloren. Als Podemos-Generalsekretärin ist die 33jährige Ione Belarra, derzeit Ministerin für soziale Rechte, im Gespräch. Die Baskin verspricht eine „gemeinschaftlichere“ Führung und will die Basis stärken, auch außerhalb des Großraums Madrid. Es wäre eine vorsichtige Korrektur des bisherigen Kurses.[5]
Konkurrenz innerhalb der Linken
Die Konzentration auf eine zentrale Figur war als Kernkonflikt bereits bei Gründung der Partei angelegt, die sich dabei an lateinamerikanischen Vorbildern orientierte. „Als charismatische Führungsfigur sollte Iglesias als Gesicht der Partei die unterschiedlichsten Strömungen aller mit dem Status quo Unzufriedenen vereinen“, erklärt Riveiro. Die personalistische Kampagne brachte zunächst gute Ergebnisse, doch die ursprüngliche Stärke entpuppte sich zunehmend als Schwäche. Da die Glaubwürdigkeit des politischen Projekts eng an die Person Iglesias gekoppelt war, schädigten dessen politisch-ästhetische „Fehltritte“ auch nachhaltig die Partei. Als Iglesias mit seiner Lebensgefährtin aus der Stadtwohnung in ein 260-Quadratmeter-Chalet mit Pool zog, sorgte das für einen Aufschrei in der Wählerschaft. Das Paar musste sich einer parteiinternen Vertrauensabstimmung stellen.
Dazu kamen strategische Differenzen. Als Podemos 2016 aus wahltaktischen Überlegungen das bis heute bestehende Wahlbündnis mit der linken Sammelpartei Izquierda Unida einging, zu der auch Spaniens Kommunistische Partei gehört, fürchtete die Fraktion um Parteimitgründer Íñigo Errejón eine zu starke Ideologisierung. Der Konflikt endete mit dem Ausschluss Errejóns, der prompt eine eigene Partei gründete: Más Madrid/Más País. Die Abspaltung ist mit ihrem links-grünen Profil inzwischen eine ernstzunehmende Konkurrenz für Podemos geworden. Bei den Madrider Regionalwahlen wurde Más Madrid mit der Ärztin Mónica García als Spitzenkandidatin nicht nur zweitstärkste Kraft, sondern überholte sogar die Sozialdemokraten des PSOE.
Iglesias wollte Más Madrid ursprünglich zu einer gemeinsamen Kandidatur überreden – unter seiner Führung. Doch Garcías Antwort war eindeutig: Nachdem sie während der Pandemie ihre Arbeit als Ärztin und Politikerin unter einen Hut habe bringen müssen, sei sie nun nicht bereit zurückzustecken. „Wir Frauen sind es müde, die Schmutzarbeit zu machen, um dann in historischen Momenten zur Seite zu treten“, so García. Für das Ego des Ex-Podemos-Chefs war das eine schallende Ohrfeige – und ein beredtes Beispiel dafür, wie sehr Iglesias‘ Hybris der Partei in der aktuellen Gemengelage schadete.
Was bleibt von den »Empörten«?
Auch in solchen Auftritten zeigt sich, wie sehr sich Podemos von der Tradition der Empörtenbewegung entfernt hat. Zwar gilt die Partei in der öffentlichen Wahrnehmung vielen immer noch als ihre Erbin, doch in den hierarchischen Strukturen und im Fokus auf Einzelpersonen zeigen sich substanzielle Unterschiede zum damaligen Aktivismus. Podemos war Nutznießerin der Bewegung, eine dauerhafte politische Heimat konnte sie den „Empörten“ aber nicht bieten: Auch das erklärt die sinkenden Umfragewerte.
Zudem ist der Politisierungsschub, der Spanien damals erfasste, zehn Jahre nach den Protestcamps des „15M“ weitgehend verebbt. Beflügelt vom Kollektiverlebnis, erhielten nach dem Frühsommer 2011 zunächst Bürgerinitiativen wie die „Plattform der Hypothekengeschädigten“ oder die gegen Kürzungen und Privatisierungen protestierenden „Mareas“ enormen Zuwachs. Aus ihnen rekrutierten sich auch viele der Aktivist*innen, die – teils gemeinsam mit Podemos – bei den Kommunalwahlen 2015 antraten, allen voran Barcelonas Wohnraumaktivistin Ada Colau und die Madrider Richterin Manuela Carmena. In über einem Dutzend spanischer Großstädte, darunter die Metropolen Madrid und Barcelona, eroberten diese alternativen Listen damals die Rathäuser.
Für den Sozialforscher Jordi Mir von der Universität Pompeu Fabra repräsentieren sie den eigentlichen institutionellen Widerhall des „15M“. Denn im Gegensatz zu Podemos hätten diese Bewegungen den Kollektivgedanken ernst genommen und ein Betätigungsfeld gewählt, das basisdemokratischen Bewegungen am nächsten steht: die Kommune. „Der inhaltliche Fokus lag dabei ganz klar auf den materiellen Lebensbedingungen, auf konkreten Veränderungen des Umfelds, jenseits ideologischer Grundsatzfragen.“ Bis auf Barcelona und Cádiz befinden sich die Rathäuser zwar inzwischen wieder in den Händen traditioneller Parteien. Doch daraus dürfe man nicht schließen, dass auch die Ideen des „15M“ verschwunden seien: „Dass die Monarchie in Spanien inzwischen kritisch hinterfragt wird und auch der Umgang mit der Diktatur sowie das spanische Modell der Demokratisierung auf dem Prüfstand stehen, ist ein Nachhall der Empörtenbewegung“, so Mir.
In der aktuellen politischen Debatte erkennt der Soziologe Verschiebungen im „mentalen Rahmen“: Gab während der Finanzkrise der damals regierende PSOE noch der Schuldentilgung den Vorrang vor öffentlichen Ausgaben, genießen nun Sozialprogramme oberste Priorität. Das liege nicht allein am Druck des kleineren Koalitionspartners Podemos – sondern verdanke sich auch der Erfahrung, dass scheinbar aus dem Nichts eine Protestbewegung entstehen kann.
[1] Vgl. Pablo Iglesias y Sánchez, los políticos mejor valorados, in „El Mundo“, 24.11.2014.
[2] Aitor Riveiro, El cielo tendrá que esperar. Un recorrido por los primeros tres años de vida de Podemos. Editorial Libros.com 2017.
[3] Daten des Meinungsforschungsinstituts CIS vom 19.4.2021, aufgearbeitet von EP Data, www.epdata.es.
[4] Wie das funktionierte, zeigt der spanische Filmemacher Fernando León de Aranoa in seinem Dokumentarfilm „Política, manual de instrucciones“, für den er die Führungsriege von Podemos von der Gründung bis zum Einzug ins Parlament begleitet hat.
[5] Aitor Riveiro, Ione Belarra: necesitamos el Podemos más fuerte, in: „Eldiario.es“, 11.5.2021.