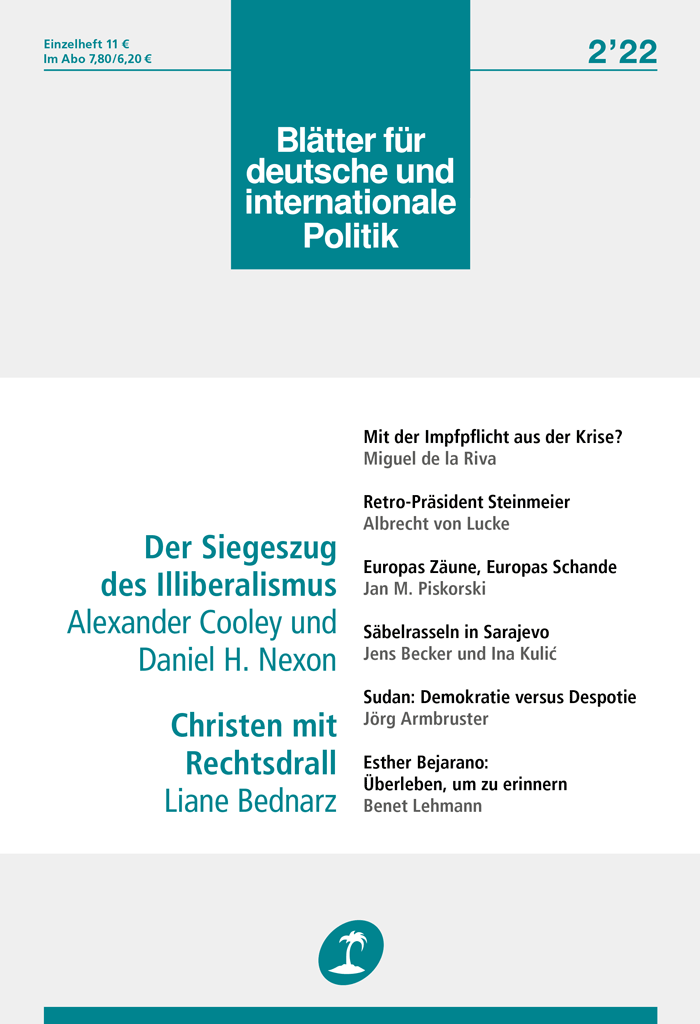Bild: Der 16jährige Peia Kararaua schwimmt durch ein überschwemmtes Gebiet, um sein Haus im Dorf Aberao im pazifischen Inselstaat Kiribati zu erreichen (IMAGO / ZUMA Press)
Nicht erst seit dem jüngsten UN-Klimagipfel in Glasgow und dem Antritt der Ampelregierung warnen Klimapolitiker*innen wie -aktivist*innen völlig zu Recht: Das kommende Jahrzehnt wird entscheidend dafür sein, ob es uns gelingt, den von Wissenschaftler*innen prognostizierten Klimakollaps noch abzuwenden, zumindest aber zu mindern. Dabei wird allerdings ein wissenschaftsbasierter Ansatz allein keineswegs ausreichen, um eine wirklich gerechte Transition unserer Gesellschaften und Wirtschaftssysteme in ein klimaneutrales Zeitalter zu erreichen. Nötig dafür sind vielmehr ein menschenrechtsbasierter Ansatz sowie ein klares Verständnis der historischen Verantwortung für die Klimakrise und die überaus ungleiche Verteilung der durch den Klimawandel verursachten Schäden.
In der klimapolitischen Debatte spielten Menschenrechte lange keine Rolle: Im Paris-Abkommen beispielsweise wird den menschenrechtlichen Verpflichtungen von Staaten praktisch keine Bedeutung beigemessen. Auch bei der COP26 in Glasgow war wenig von Menschenrechten die Rede. Klima-Aktivist*innen ebenso wie die großen Umweltverbände bedienten sich lange überhaupt nicht der Sprache der Menschenrechte, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Aber auch klassische Menschenrechtsorganisationen und -aktivist*innen fingen erst in den vergangenen Jahren damit an, menschenrechtliche Probleme in einen Zusammenhang mit der Klimakrise zu stellen.