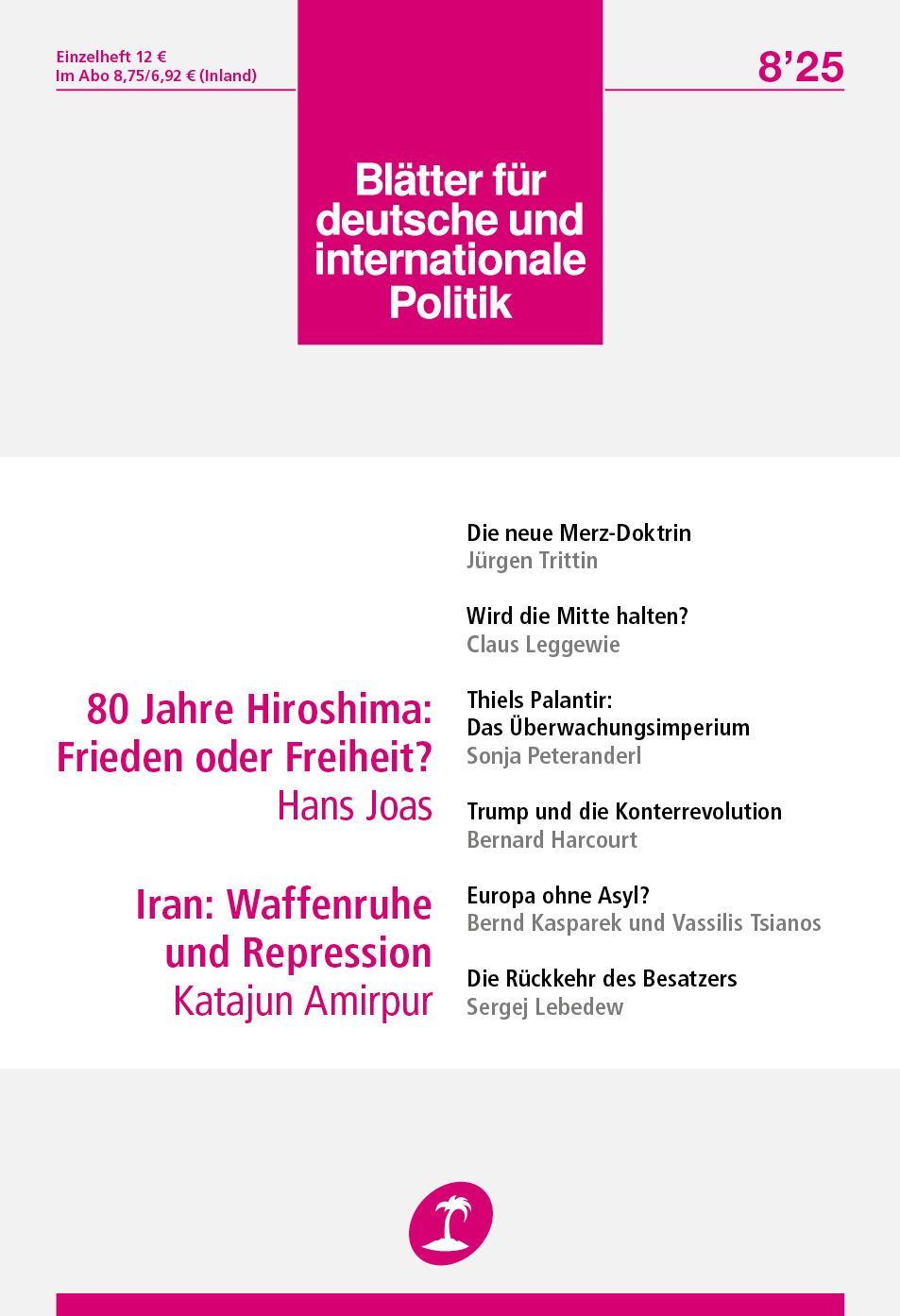Bild: Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche, 9.5.2025 (IMAGO / Sven Simon)
Ob es um die Brandmauer gegen die AfD, die Schuldenbremse oder die Stromsteuer geht – auf das Wort von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ist kein Verlass. Im Wahlprogramm von CDU und CSU steht: „Wir senken die Stromsteuer für alle und reduzieren die Netzentgelte.“ Auch im Koalitionsvertrag hatten Union und SPD vereinbart, die Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß zu senken. Das wäre gut für die Stromkunden und das Klima. Doch schon nach wenigen Wochen brach Schwarz-Rot dieses Versprechen. Statt die Stromsteuer für alle zu senken, soll die Gasspeicherumlage künftig ausgerechnet aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) finanziert werden. Dadurch wird das Heizen mit fossilem Gas billiger. Das könnte den Umstieg auf Wärmepumpen und grünen Strom bremsen. Damit drohen sich auch die Klimaziele der Koalition schon jetzt in ein leeres Versprechen zu verwandeln.
Aber vielleicht ist genau das gewollt? Es passt jedenfalls zu dem bisherigen Kurs der neuen Ministerin für Wirtschaft und Energie, Katherina Reiche (CDU). Reiche war bis zu ihrem Amtsantritt Chefin der Eon-Tochter Westenergie, einem der größten Gasnetzbetreiber Deutschlands. Schon bei ihrer Ernennung zur Bundesministerin warnte LobbyControl vor Interessenkonflikten. Einige fanden das damals übertrieben. Doch Reiche versucht nicht einmal, den Eindruck zu vermeiden, sie sei der verlängerte Arm der Gaslobby in der Bundesregierung.
Sie will auf der Insel Borkum, nahe dem Wattenmeer, einem UNESCO-Weltnaturerbe, Gas fördern lassen. Es sollen neue Gaskraftwerke gebaut werden, ohne dass diese später mit Wasserstoff betrieben werden können, sie schimpft über einen angeblichen „Wärmepumpenzwang“ (den es nicht gibt) und meint, Robert Habeck (Grüne) habe den Klimaschutz „überbetont“. Den Ausbau von Wind- und Solarenergie, der unter ihrem Vorgänger Habeck endlich wieder an Schwung gewonnen hatte, nannte sie „völlig überzogen“. Ginge es nach ihr, sollen erneuerbare Energien finanziell unattraktiver werden, sie will den „Business-Case noch mal nach unten“ bringen. Da drängt sich die Frage auf: Wer profitiert davon? Fossile Autokraten und die Gasnetzbetreiber, darunter auch Reiches ehemaliger Arbeitgeber.
Wortbruch mit Folgen
Es wäre gerechter, die Menschen durch ein Klimageld zu entlasten, statt die Stromsteuer zu senken. Denn von einer Senkung der Stromsteuer profitiert am meisten, wer viel Strom verbraucht. Arme Menschen verbrauchen meist viel weniger Energie. Doch ein Klimageld ist von Schwarz-Rot politisch nicht gewollt. Union und SPD haben bisher keinen Plan für den sozialen Ausgleich für Menschen mit geringem Einkommen. Das könnte sich noch rächen, wenn ab 2027 auch Gebäude und Verkehr in den EU-Emissionshandel (ETS 2) einbezogen werden und die Preise für Erdgas, Heizöl und Benzin steigen.
Trotzdem: Da wir nur klimaneutral werden können, wenn wir unsere Wirtschaft so weit wie möglich elektrifizieren, hätte die Senkung der Stromsteuer zumindest eine positive Lenkungswirkung. „China elektrifiziert die gesamte Volkswirtschaft schneller als jedes andere Land der Welt. Und wird damit auch schneller die Vorteile weiter sinkender Energiepreise genießen“, sagt der frühere VW-Chef Herbert Diess.[1] Reiche scheint dies noch nicht verstanden zu haben.
Wer mit Erdgas heizt, soll von der Gasspeicherumlage entlastet werden, wer hingegen klimafreundlich mit einer Wärmepumpe heizt oder ein Elektroauto fährt, soll weiterhin 2,05 Cent pro Kilowattstunde (kWh) Stromsteuer bezahlen – der EU-Mindestsatz liegt bei nur 0,05 Cent. Was für ein Irrsinn! Dabei verursacht eine Wärmepumpe mit dem aktuellen Strommix 40 bis 60 Prozent weniger CO2 als moderne Gasheizungen. Wird eine Wärmepumpe nur mit Ökostrom betrieben, ist sie praktisch klimaneutral.
Die Bundesregierung betont, immerhin werde die Stromsteuer für Industrie und produzierendes Gewerbe gesenkt. Doch für diese hat bereits die Ampel die Stromsteuer auf das europäische Minimum gesenkt – eine weitere Senkung gibt es auch hier nicht. Die Stromsteuersenkung der Ampel war aber zeitlich befristet. Es ist gut, dass sie nun auf Dauer bestehen bleibt. Aber eine Nichterhöhung ist keine Steuersenkung, so viel Genauigkeit muss sein.
Zumindest bei den Netzentgelten sollen auch die Stromkunden entlastet werden. Aber wie der Journalist Malte Kreutzfeldt auf Bluesky vorgerechnet hat, weckt die Regierungauch hier unrealistische Erwartungen. Denn die einzige Maßnahme, von der alle Verbraucher profitieren, ist der geplante Zuschuss zu den Netzentgelten. „Weil sich der regional unterschiedlich auswirkt, mag es Orte geben, wo das drei Cent pro kWh bringt – das dürfte aber die Ausnahme sein“, so Kreutzfeldt. Im bundesweiten Durchschnitt reiche der angekündigte Zuschuss von 6,5 Mrd. Euro nur für eine Senkung von ungefähr 1,5 Cent pro kWh. Für andere Wahlversprechen haben CDU/CSU und SPD genug Geld: Für die niedrigere Gastrosteuer, die Agrardiesel-Subvention oder die schon angesprochene Finanzierung der Gasspeicherumlage aus dem KTF – aber die rund 5,4 Mrd. Euro für die versprochene Stromsteuersenkung sollen nicht finanzierbar sein? Es ist eben alles eine Frage der Prioritäten.
Einige Unionspolitiker:innen glauben, man könne die fehlenden 5,4 Mrd. bei der Förderung von Wärmepumpen streichen. So behauptete Markus Söder (CSU) am 6. Juli im ZDF, Wärmepumpen würden mit 16 Mrd. Euro pro Jahr gefördert. Das Problem an seiner Rechnung: Die 16 Mrd. sind die Gesamtförderung im Gebäudesektor, sie fließen vor allem in Gebäudedämmungen. Die Förderung von Wärmepumpen beläuft sich derzeit nur auf etwa drei Mrd. Euro pro Jahr.
Klima-Aufschieberitis
Auf dem Tag der Industrie Ende Juni in Berlin zweifelte Reiche öffentlich an den Klimazielen, die noch unter Angela Merkel im Klimaschutzgesetz verankert wurden: „Ja, die Bundesregierung, frühere, haben Ziele – ich weiß nicht, ob man das sich vorher tatsächlich immer durchgerechnet hat – nach vorn verschoben und das Ambitionsniveau noch einmal nach oben geschraubt. Und ich glaube, eine Harmonisierung mit internationalen Zielen täte gut.“ Sie sagte auch, dies sei in der Koalition nicht vereinbart, aber man müsse prüfen, „was in welchen Zeiträumen zu welchem Preis machbar ist“. Man konnte sie nur so verstehen, dass sie das nationale Ziel für die Klimaneutralität einfach um fünf Jahre nach hinten, auf 2050, verschieben will, obwohl das dem Koalitionsvertrag widerspricht. Sandra Maischberger sprach Friedrich Merz in ihrer Sendung darauf an, und er stimmte zu. Er sagte, Reiches Aussagen hätten „mit der realistischen Einschätzung dessen zu tun, was wir tatsächlich erreichen können“. Mit der Einschätzung, dass mit der aktuellen Politik ein klimaneutrales Deutschland bis 2045 unrealistisch ist, haben Merz und Reiche ja sogar recht. Doch deshalb das Ziel aufzugeben, ist nicht die einzige mögliche Schlussfolgerung. Man könnte auch einfach Maßnahmen ergreifen, mit denen man dem Ziel näherkommt.
Das Infragestellen von Klimazielen und der Wortbruch bei der Stromsteuer beschädigen die Glaubwürdigkeit – nicht nur bei den Wähler:innen, sondern auch gegenüber der Wirtschaft, die auf Planungssicherheit angewiesen ist. „Wir müssen endlich dazu kommen, nicht immer wieder alte Päckchen aufzuschnüren und alte Grundsatzdebatten alle vier Jahre neu zu führen. Das wirft uns jedes Mal um Jahre zurück“, sagte Tim Meyerjürgens, Chef des Stromnetzbetreibers Tennet Deutschland der Wirtschaftswoche.[2] Reiches Argument, die Industrie benötige mehr Zeit, überzeugt nicht. Die Industrie ist längst Teil des Europäischen Emissionshandels ETS 1. Laut EU-Kommission endet der Zertifikatehandel spätestens 2045 bei Netto-Null. Dann gibt es keine freien Emissionszertifikate mehr – auch nicht für Stahl-, Zement- oder Chemieunternehmen. Felix Matthes vom Öko-Institut sagt: „Für alles, was mit Energie zu tun hat, müssen die Emissionen deutlich vor 2045 bei null liegen.“ Das gilt auch für den ETS 2, der nicht die Industrie, aber den Verkehrs- und Gebäudesektor betrifft. Auch dieser soll bis 2045 auf null laufen, deshalb haben auch Autofahrerinnen oder Hausbesitzer nichts davon, wenn Deutschland Klimaschutzmaßnahmen auf die lange Bank schiebt.
Reiche schwebt jetzt vor, das nationale Ziel für die Klimaneutralität einfach um fünf Jahre nach hinten, auf 2050, zu verschieben. Ihr geplantes Ausbremsen der Energiewen-de passt aber auch zu diesem Ziel nicht. Deutschland muss sehr viel mehr tun als heute, um auch nur 2050 bei Null-Emissionen zu landen. Ein späteres nationales Ziel, wenn es ernst gemeint ist, verschafft der Industrie keine zusätzliche Zeit, sondern destabilisiert das europäische Klimasystem, analysiert der „Spiegel“-Journalist Jonas Schaible in seinem Newsletter: „Wenn das große, einflussreiche Deutschland sein Klimaziel aufweicht, dann wird es wahrscheinlicher, dass andere Staaten das auch tun.“[3] Weniger Ambition beim Klimaschutz bedeutet auch, dass uns andere Länder bei wichtigen Zukunftstechnologien überholen. China hat allein im Mai 2025 so viel Photovoltaik-Kapazität aufgebaut, wie in Deutschland insgesamt bis Ende 2024 installiert war. Die Investmentbank Lazard schreibt ihn ihrem jährlichen Bericht: „Erneuerbare Energien bleiben die kostengünstigste Form neuer Stromerzeugungsanlagen ohne Subventionen.“[4] Insbesondere die Kosten für Kombinationen aus Solar- oder Windkraftwerken mit angeschlossenem Speicher sind bemerkenswert niedrig. Doch viele Politiker:innen bei CDU und CSU scheinen immer noch zu glauben, Klimaschutz schade unserer ökonomischen Wettbewerbsfähigkeit. Das Gegenteil ist der Fall: Wer sich zu lange an veraltete fossile Technologien klammert, der wird seine Wettbewerbsfähigkeit verlieren.
Das Klima schickt die Rechnung
Der Satz „Die Sonne schickt uns keine Rechnung“ sei bekloppt, so Reiche. Das war der Titel eines Buches des ehemaligen Fernsehjournalisten und früheren CDU-Mitglieds Franz Alt. Gemeint war damit: Wind- und Solarenergie haben keine Brennstoffkosten. Das ist ein unschlagbarer ökonomischer Vorteil. 63,5 Mrd. Euro kosteten uns 2024 die Öl- und Gasimporte – Geld, das wir besser in Klimaschutz und Klimaanpassung investieren sollten! Reiche argumentiert mit den Kosten für den Ausbau der Stromnetze. Natürlich braucht man für ein System mit vielen dezentralen Stromerzeugern ein anderes Stromnetz als für eines mit wenigen Großkraftwerken. Aber auch ohne Energiewende müssten wir unser Stromnetz modernisieren. Der Netzausbau wäre dann vielleicht etwas günstiger, aber dafür müssten wir Unsummen für den Bau neuer fossiler Großkraftwerke ausgeben, die höhere Stromgestehungskosten als Solar- und Windkraftanlagen haben – auch ohne CO2-Preis.[5] Der Netzausbau wurde unter Angela Merkel verschleppt. „Unter Robert Habeck herrschte im Bundeswirtschaftsministerium schon ein anderer Zug und ein höheres Tempo beim Thema Genehmigungen“, sagt Meyerjürgens. „Früher dauerte es im Schnitt acht bis zwölf Jahre, bis wir eine neue Höchstspannungsleitung genehmigt bekamen; zuletzt ging das mindestens doppelt so schnell.“ Anders als Reiche suggeriert, können wir durch den Netzausbau sogar Geld sparen. Alleine durch die Höchstspannungsleitung von Ganderkesee bei Bremen Richtung Nordrhein-Westfalen, die Windstrom nach Süden transportiert, wurden bereits etwa 500 Mio. an Kraftwerkskosten eingespart, so Meyerjürgens.
Die Sonne schickt uns keine Rechnung, die Klimakrise schon: Extremwetterereignisse nehmen durch die Erderwärmung weltweit zu und verursachen immer höhere Kosten. Auch in Deutschland zeigt sich die Klimakrise durch Trockenheit, Ernteausfälle, Waldbrände, Hitzewellen, Überschwemmungen, Starkregen und Stürme. Jährlich führt die Luftverschmutzung durch fossile Kraftwerke zu etwa 30 000 vorzeitigen Todesfällen in Deutschland. Die Klimakrise treibt Lebensmittelpreise in die Höhe, zwingt Menschen im Globalen Süden zur Flucht und verschärft internationale Konflikte. Hätten wir nicht jahrelang Erdgas in Russland gekauft und so Putins Kriegskasse gefüllt, müssten wir jetzt vielleicht nicht immense Summen in unsere Verteidigung stecken.
Es wäre töricht, den Ausbau der erneuerbaren Energien zu bremsen. Doch genau das will Reiche offenbar erreichen, auch mit dem sogenannten Energiewendemonitoring. Offiziell sollen die beauftragten Gutachter:innen bis August herausfinden, wie die Energiewende verlässlicher und kostengünstiger gestaltet werden kann. Doch die Leistungsbeschreibung für das Monitoring zeigt, dass der Strombedarf für 2030 und damit der Bedarf für Netzausbau und erneuerbare Energien kleingerechnet werden soll. Statt Innovationen in Schlüsselbereichen voranzutreiben, scheint Ministerin Reiche Stillstand verwalten zu wollen. Wo sind die Pläne für den Ausbau von klimafreundlichem Stahl, Speichern, Wärmepumpen oder E-Mobilität?
Doch so sehr sich Katherina Reiche auch gegen den technischen Fortschritt stemmt, am Ende wird sich die effizientere und saubere Technik durchsetzen. Das Problem ist nur, dass wir durch die Verzögerungstaktik der Öl- und Gaslobby wertvolle Zeit im Kampf gegen die Erderwärmung verlieren. Während der Hitzewelle Anfang Juli versammelten sich erfreulich viele Menschen spontan abends um 22 Uhr zu einer Klimademo vor dem Bundeswirtschaftsministerium in Berlin. Immerhin ein Hoffnungsschimmer. Vielleicht sorgt die Fossilministerin Reiche ungewollt für ein Wiedererstarken der Klimabewegung. Dringend nötig wäre es.
[1] Herbert Diess, Wir diskutieren immer noch über Gaskraftwerke, wiwo.de, 10.6.2025.
[2] Tim Meyerjürgens, Wir können nicht alle vier Jahre einen Richtungswechsel gebrauchen, wiwo.de, 21.2.2025.
[3] Jonas Schaible, Das Klimaziel zu verschieben, ist keine Lösung, beimwort.substack.com, 4.7.2025.
[4] Lazard, Levelized Costello of Energy, lazard.com, Juni 2025.
[5] Christoph Kost u.a., Stromgestehungskosten erneuerbare Energien, fraunhofer.de, Juli 2024.