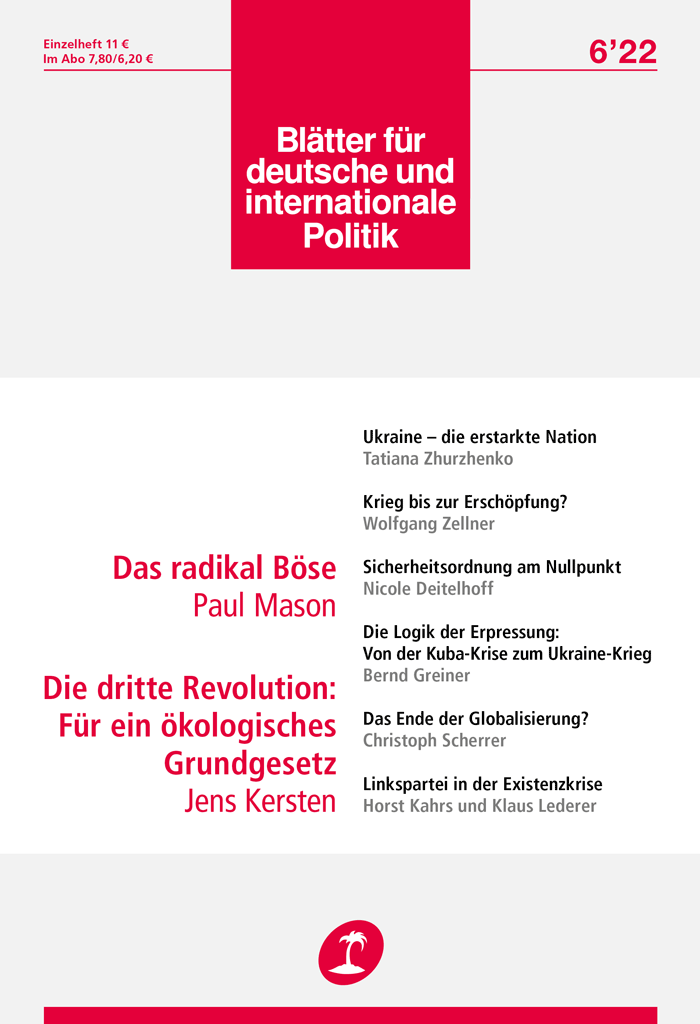Bild: Mosambikanische Soldaten auf dem Truppenübungsplatz Pesochnoe in Russland, 29.8.2020 (IMAGO / ITAR-TASS)
Seit nunmehr fünf Jahren bekriegen sich in der Provinz Cabo Delgado im Norden Mosambiks Regierung und verschiedene Rebellengruppen. Doch auch elf Monate nach dem Eingreifen internationaler Streitkräfte auf Seiten der Regierung ist eine friedliche Lösung weiterhin nicht in Sicht.
Zwar sprechen die mosambikanische Regierung und ihre militärischen Verbündeten aus Ruanda und der Entwicklungsgemeinschaft des Südlichen Afrika (Southern African Development Community, SADC) von einer stabilisierten Situation, verkünden Wiederaufbaupläne und drängen Menschen, die vor dem Konflikt geflohen sind, zur Rückkehr in ihre Heimatorte. Doch religiöse und zivilgesellschaftliche Gruppen zeichnen ein völlig anderes Bild.[1] Ihnen zufolge herrscht in der Bürgerkriegsprovinz nach wie vor ein Klima der Angst. Abseits der von den Interventionstruppen kontrollierten Städte halten die brutalen Überfälle von Rebellengruppen auf wehrlose Dörfer an. Und noch immer sind etwa 800 000 Menschen als Binnenvertriebene auf der Flucht. Laut der Internationalen Organisation für Migration (IOM) ist ihre Zahl zwischen November 2021 und Februar 2022 sogar nochmals um sieben Prozent gestiegen.[2]
Schon seit 2017 kommt es in Cabo Delgado, der trotz ihres enormen Rohstoffreichtums armen Provinz an der Grenze zu Tansania, immer wieder zu gewaltsamen Aufständen verschiedener Rebellengruppen.