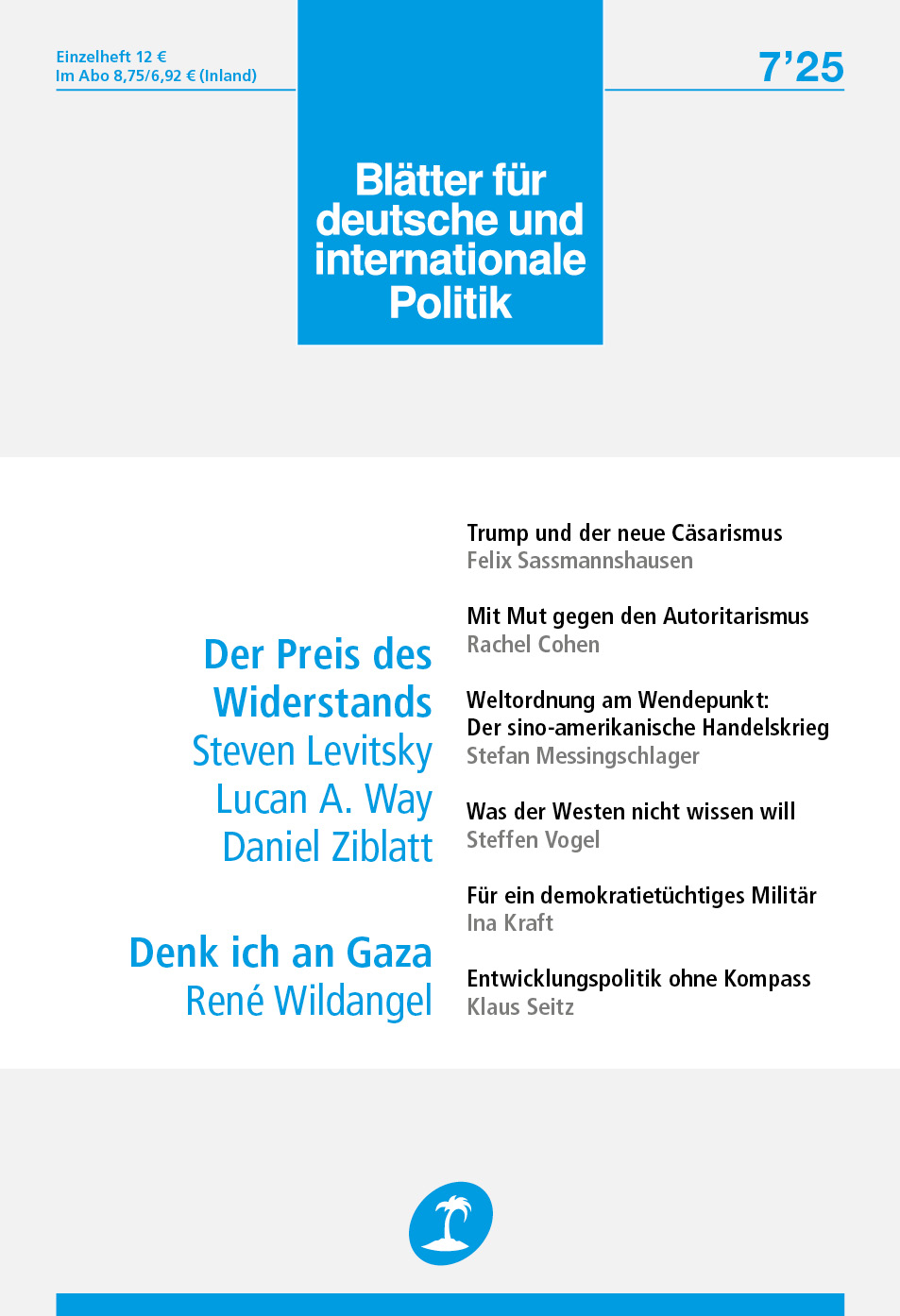Bild: Migranten protestieren vor dem Büro des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR) in Zarzis, Tunesien. Sie fordern den Schutz der UNO für Flüchtlinge, 25.1.2024 (IMAGO / ZUMA Press Wire / Hasan Mrad)
Die EU verkauft es als Erfolg: Die Zahl der in ihren Mitgliedsländern gestellten Asylanträge ist 2024 um zwölf Prozent gesunken.[1] Doch diese „Erfolgsmeldung“ verdeckt, dass die niedrigeren Zahlen mit Menschenrechtsverletzungen an den Außengrenzen der Union einhergehen, verübt zumeist durch Sicherheitskräfte von Staaten, die von der EU und auch Deutschland finanziert und ausgebildet werden. Eines dieser Länder ist Tunesien, das viele Asylsuchende auf ihrem Weg nach Europa durchqueren.
Das nordafrikanische Land galt nach der Revolution von 2010 und 2011 als Leuchtturmdemokratie des Mittleren Ostens und Nordafrikas: Demokratische Strukturen wurden bis in die kommunale Ebene etabliert und Gewerkschaften für Frauen geöffnet. Die EU und viele ihrer Mitgliedstaaten begannen, in den Demokratisierungsprozess Tunesiens zu investieren. Die Transformations- und die Ta’ziz-Partnerschaft des Auswärtigen Amtes etwa unterstützte den Aufbau zivilgesellschaftlicher Strukturen und eines pluralistischen Mediensystems, internationalen zivilgesellschaftlichen und kulturellen Austausch sowie die Förderung von Frauen. Zudem schuf die EU mit der Aufnahme Tunesiens in das Erasmusprogramm eine Möglichkeit für universitären Austausch; mit der Förderung von LGBTIQ+-Projekten unterstützte sie den Minderheitenschutz. Sicherlich spielten schon damals auch eigene Interessen der EU und Deutschlands für das Engagement eine Rolle. Man wollte sich auf diese Weise mehr Einfluss in dem Mittelmeerstaat sichern und Türen öffnen, etwa für eine Zusammenarbeit im Rahmen der deutschen Energiewende.
Ab 2019 dann begann die Abschottung der EU-Außengrenzen die Kooperation mit Tunesien zu dominieren, kam die Wende hin zur interessengeleiteten Realpolitik, bei der für Menschenrechte und Demokratie kaum mehr Platz ist. Die EU und auch Deutschland begannen unter dem Vorwand, Schlepper und Schmuggel zu bekämpfen, im Rahmen der „Strategischen Partnerschaft“ mit den tunesischen Sicherheitskräften beim Grenzschutz zusammenzuarbeiten. Seit 2015 bilden deutsche Bundespolizisten Mitglieder der tunesischen Grenzpolizei und Nationalgarde aus, außerdem liefert Deutschland Ausrüstung und Pick-up-Fahrzeuge.[2]
Seit 2024 finanziert die Bundesrepublik auch ein Ausbildungszentrum für die Küstenwache, stellt Speedboote und beteiligt sich an der Ausbildung von Personal für die im Juni 2024 eingerichtete Such- und Rettungszone (SAR) auf dem Mittelmeer, die die Bergung von Menschen in Seenot effizienter gestalten soll. Die Einrichtung der Zone ist eine Schlüsselkomponente im Vorhaben der EU, ihre Seegrenzen auszulagern und Drittländer mit der Migrationskontrolle zu beauftragen.[3] In der Praxis kommt es dabei Berichten zufolge immer wieder zur Anwendung von Gewalt gegenüber Migrant:innen durch tunesische Grenzschützer:innen.
Fest steht: Das deutsche wie das EU-Engagement in Tunesien vollzogen in den vergangenen Jahren einen radikalen Wandel. Heute scheint das Ziel, die Einwanderungszahlen zu senken, eindeutig Vorrang vor dem Respekt der Menschenrechte zu haben.
Von der Demokratieförderung zur Migrationsabwehr
Die EU schaut heute auch weg, wenn der tunesische Staatspräsident Kais Saied die einzige Demokratie der Region zu einem präsidentiellen System ohne Gewaltenteilung umbaut, die Bürgerrechte im Land einschränkt und damit die Errungenschaften des Arabischen Frühlings zunichte macht.
Der Demokratieabbau begann 2021, als Präsident Saied die tunesische Regierung nach massiven Protesten der Bevölkerung absetzte und das Parlament vorübergehend „einfror“. Zu diesem Zweck machte er vom Notstandsartikel der tunesischen Verfassung Gebrauch. Anschließend löste er das Parlament und den Obersten Justizrat auf, verabschiedete ein Dekret, das die Pressefreiheit im Namen der Bekämpfung von Fake News einschränkt, und änderte die Verfassung. Führende Oppositionspolitiker:innen wie der Vorsitzende der islamischen Ennahda-Partei, Rached Ghannouchi, die im postrevolutionären Tunesien eine entscheidende Rolle gespielt hatten, wurden inhaftiert, ebenso wie einige Journalist:innen.
Doch ungeachtet des fortgeschrittenen Demokratieabbaus unterzeichneten Vertreter:innen der EU und Tunesiens im Juli 2023 mit dem Memorandum of Understanding eine Absichtserklärung, die eine stärkere Zusammenarbeit in Wirtschafts- und Handelsfragen, der Energiewende und beim Thema Migration vorsieht, vor allem aber auf den Grenzschutz abzielt. Treibende Kraft hinter dem Abkommen war die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Auch wenn in den vergangenen Jahren in Deutschland im europäischen Vergleich die meisten Asylanträge gestellt wurden, gehört Italien wegen seiner geographischen Lage zu den am häufigsten von Migrant:innen angesteuerten Zielländern der EU.[4] Seit 2020 waren die Ankünfte über die zentrale Mittelmeerroute, die von der südlichen Küste Tunesiens oder der westlichen Küste Libyens zur italienischen Insel Lampedusa führt, stark angestiegen. 2022 kamen auf diesem Weg 105 600 Asylsuchenden in die EU, mehr als doppelt so viele wie über andere Fluchtrouten.[5] Darunter sind nicht nur Menschen aus Ländern südlich der Sahara, sondern auch Tunesier:innen, die 2024 insgesamt zwölf Prozent der Ankommenden in Italien ausmachten.[6]
Auch aus diesem Grund zielt das Abkommen neben dem Schutz der europäischen Außengrenzen auch auf die finanzielle Stabilität Tunesiens. Denn das Land befindet sich seit Jahren in einer wirtschaftlichen Krise und stand 2023 mit einer Schuldenquote von 90 Prozent im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt kurz vor dem Staatsbankrott. Diese finanzielle Instabilität beunruhigt Europa, vor allem da Staatspräsident Saied die Bedingungen weitgehender Liberalisierung im Gegenzug für einen Kredit des Internationalen Währungsfonds ablehnte. Ein Staatsbankrott hätte die Migration nach Europa entscheidend befeuert und die gesamte Region destabilisiert. Deshalb waren die im Memorandum in Aussicht gestellten 105 Mio. Euro für den Grenzschutz sowie 150 Mio. Euro Zuschüsse zum tunesischen Staatshaushalt ein sehr willkommenes Instrument, um Tunesien finanziell zu stabilisieren.[7] Pushbacks und Verschleppungen
Tatsächlich scheint die Kooperation beim Grenzschutz im Sinne der Migrationsabwehr zu wirken: Seit Unterzeichnung des Memorandums hat sich die Zahl der Migrant:innen, die ohne Papiere nach Europa einreisen, drastisch verringert. Waren es im Juli 2023 noch 19 841, lag die Zahl ein Jahr später bei nur noch 1819.[8] Erreicht wurde diese Reduktion allerdings nicht zuletzt durch menschenrechtswidrige Praktiken wie Pushbacks auf dem Meer sowie die Verfrachtung von Migrant:innen an Tunesiens Landesgrenzen zu Libyen und Algerien, darunter auch in Wüstengebiete.[9] „Es gibt einen politischen Druck auf die Küstenwache, die Menschen an der Ausreise zu hindern, egal wie hoch der Preis ist, egal wie hoch der Schaden ist. So hat die Gewalt begonnen“[10], beschreibt Romdhane Ben Amor von der tunesischen NGO „Forum tunisien pour les droits socio-economiques“ die Folgen der EU-Abschottungspolitik in Tunesien.
Im Land selbst geht die Regierung seit der Unterzeichnung des Abkommens mit voller Härte gegen Migrant:innen vor: Im Juli 2023 wurde eine große Zahl von Migrant:innen aus der Hafenstadt Sfax abtransportiert und jenseits der Grenze zu Libyen und Algerien ausgesetzt.[11] Ein Jahr später fand wieder eine Massenabschiebung statt. Diesmal stammten die Migrant:innen aus einem Camp, das sich nahe der Einrichtungen der Internationalen Organisation für Migration (IOM) und des UN-Flüchtlingswerks (UNHCR) gebildet hatte. Ein Team des „Bayerischen Rundfunks“, der Organisation Lighthouse Reports, des „Spiegel“ und weiteren internationalen Medien dokumentierte 2024 insgesamt 14 solcher Verschleppungsaktionen durch tunesische Behörden.[12]
Seit das UNHCR im Herbst 2024 – wohl auf Druck Tunesiens, das unter keinen Umständen ein Aufnahmeland für Asylsuchende werden will – die Registrierung von Asylanträgen im Land einstellte, können Geflüchtete hier kein Asyl mehr beantragen, da das tunesische Recht kein Asylgesetz kennt. Die IOM, die in Tunesien vorrangig die freiwillige Rückkehr von Migrant:innen ohne Papiere organisiert, eröffnete unterdessen zwei weitere Standorte, um Rückführungen aus der EU zu beschleunigen.
Zugleich fanden 2024 die ersten Verhaftungen von Aktivist:innen statt, die humanitäre Hilfe für Geflüchtete geleistet hatten – es sind Dynamiken, die der Kriminalisierung von zivilen Seenotretter:innen durch italienische Behörden ähneln. Besonders erschreckend ist der Fall von Cherifa Riahi, der ehemaligen Vorsitzenden von Terre d’Asile in Tunesien, deren zweites Kind zum Zeitpunkt der Festnahme erst zwei Monate alt war. Erst über zehn Monate nach ihrer Festnahme durfte sie ihr Kind wiedersehen. Im März dieses Jahres hat man zwar die Vorwürfe wegen Geldwäsche gegen sie fallenlassen, aber sie befindet sich wegen anderer Vorwürfe weiter in Untersuchungshaft. Daneben wurden auch drei Journalist:innen festgenommen, die in einer Talkshow des französischen Fernsehsenders „France 24“ über das staatliche Vorgehen gegen Migrant:innen diskutiert hatten.[13] Ein dänischer Journalist erhielt wegen einer Recherche über Migration eine sechsmonatige Ausreisesperre. Damit trägt die EU-Abschottungspolitik indirekt auch zur Einschränkung der Pressefreiheit in Tunesien bei.
Hinzu kommt die Repression gegen die Opposition im Land: Im Vorfeld der Neuwahl Saieds zum Staatspräsidenten im Oktober 2024 wurden verschiedene Präsidentschaftskandidat:innen festgenommen und Demonstrierende sowie die LGBTIQ+-Community durch Razzien und kurzzeitige Festnahmen eingeschüchtert. Die Freiräume für die Opposition werden immer kleiner: Erst im Mai wurden drei Umweltaktivist:innen auf einer Demonstration festgenommen, weil sie Mitglied in einer den öffentlichen Frieden störenden Vereinigung sein sollen.
Ein sicherer Herkunftsstaat?
Auf der anderen Seite des Mittelmeers engagiert sich die EU für die effektive Umsetzung des Memorandums. Dazu setzte sie Tunesien erst im April auf die Liste der als sicher eingestuften Herkunftsstaaten. Asylsuchende aus solchen Ländern sollen künftig geringere Chancen auf eine Flüchtlingsanerkennung haben. Nach Tunesien abzuschieben oder es als sicheres Herkunftsland einzustufen, ist jedoch schon aufgrund der Verschleppung von Migrant:innen durch tunesische Beamte fraglich, aber auch die politische Repression gegen Tunesier:innen spricht dagegen.
Ironischerweise sah sich die EU nur wenige Tage nach der Einstufung Tunesiens als sicheres Herkunftsland gezwungen, doch eine kritische Position zur Menschenrechtslage im Land zu beziehen, denn im Rahmen der Gerichtsprozesse um die sogenannte Staatsstreich-Affäre, bei der 40 tunesische Oppositionelle wegen einer angeblichen Verschwörung gegen Präsident Saied angeklagt waren, verhängte ein tunesisches Gericht harte Haftstrafen von bis zu 66 Jahren. Die Prozesse fanden unter fast vollständigem Ausschluss der Öffentlichkeit sowie diplomatischer Vertreter:innen statt. „[Die EU] hat das harte Urteil zur Kenntnis genommen”, äußerte sich die EU-Kommission und beteuert regelmäßig, mit den tunesischen Behörden im Austausch über Meinungsfreiheit und faire Gerichtsverfahren zu stehen.
Das Auswärtige Amt findet etwas deutlichere Worte: „Die Art und Weise, wie der Prozess geführt wurde, wird nach unserer Auffassung dem Recht der Beschuldigten auf ein faires und unabhängiges Verfahren nicht gerecht.“[14] Trotzdem plant die neue Bundesregierung der EU zu folgen und Tunesien neben weiteren Ländern zu einem sicheren Herkunftsstaat zu erklären. Das Kabinett hat bereits ein Gesetz auf den Weg gebracht, das eine solche Einstufung ohne Zustimmung des Bundesrats möglich machen soll.
All das zeigt: Die EU und Deutschland ignorieren aus innenpolitischem Kalkül weitgehend den Demokratieabbau und die Verletzung von Menschenrechten in Tunesien – den Preis dafür zahlen Migrant:innen wie Tunesier:innen. Damit verspielen sie ihre Glaubwürdigkeit beim Einsatz für Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Selbst wenn die EU und Deutschland ihre ehemaligen zivilgesellschaftlichen Partner:innen in Tunesien weiter unterstützen wollten, ist das nach dem Zusammenbruch der demokratischen Strukturen, dem sie fast kommentarlos zusehen, nun schwierig geworden. Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenwürde aber können nur existieren, wenn die Staaten und Gesellschaften, die sich ihnen verpflichtet fühlen, diese auch schützen. Wenn immer weniger Staaten sich für diese Werte einsetzen, fallen die nun 80 Jahre währenden Bemühungen um eine demokratische Nachkriegsordnung zusehends in sich zusammen.
[1] 2024 weniger Asylanträge in Europa, tagesschau.de, 11.1.2025.
[2] Tunesien setzt Migranten systematisch in Wüste aus, br.de, 21.5.2024.
[3] Vgl. Tunesiens Krieg gegen Migranten, nd-aktuell.de, 22.7.2024.
[4] 2024 weniger Asylanträge in Europa, a.a.O.
[5] Leaked data reveals the extent of Tunisia and the European Union’s cooperation on migration, inkyfada.com, 3.4.2025.
[6] Italien: Deutlicher Rückgang der Flüchtlingsankünfte im Dezember, vaticannews.va, 3.1.2025.
[7] Lob und Kritik zum EU-Migrationsabkommen mit Tunesien, zeit.de, 17.7.2023.
[8] Leaked data reveals the extent of Tunisia and the European Union’s cooperation on migration, inkyfada.com, 3.4.2025.
[9] Auswirkungen der Externalisierung in Tunesien, migration-control.info, 29.3.2024.
[10] Quel rôle pour la société civile après les présidentielles de 2024?, nawaat.org, 13.12.2024.
[11] In Tunesien zeigt sich: Sicherer Drittstaat ist ein dehnbarer Begriff, disorient.de, 24.7.2023.
[12] Tunesien setzt Migranten systematisch in Wüste aus, a.a.O.
[13] Verschleppung von Migrant:innen und Festnahmen in Tunesien, disorient.de, 13.5.2024.
[14] Auswärtigen Amt zu den Urteilen in der sogenannten „Staatsstreich-Affäre“ in Tunesien, auswaertiges-amt.de, 24.4.2025.