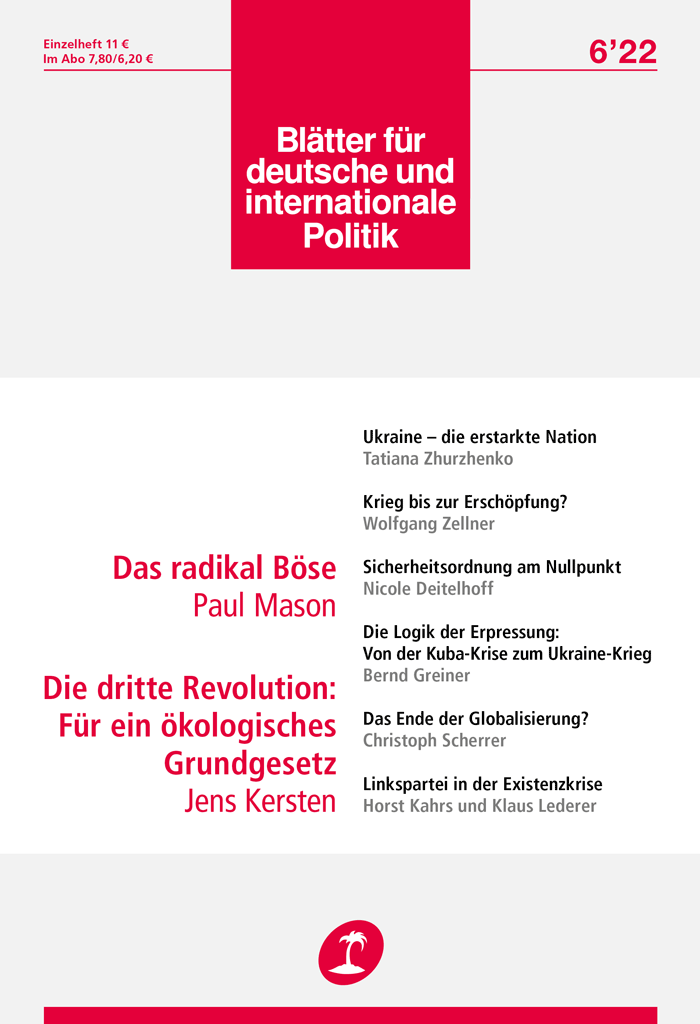Warum wir eine langfristige Strategie gegenüber Russland brauchen

Bild: Butscha, Ukraine, 6.4.2022 (IMAGO / xcitepress)
Der russische Eroberungskrieg gegen die Ukraine geht in seinen vierten Monat. Und jenseits der aktuellen militärischen Lage in der Ukraine und der weitgehend beantworteten Frage, warum und mit welchem Ziel Russland diesen Krieg begonnen hat,[1] stellen sich längst weitergehende Fragen: Worin besteht eigentlich der Charakter dieses Krieges, wer sind seine Teilnehmer? Welche Auswirkungen wird dieser Krieg auf die internationalen Beziehungen haben? Wie lässt er sich zumindest vorübergehend beenden? Und wie sollte man sich die eher lange Periode bis zu einem dauerhaften Frieden vorstellen?
Einer Antwort auf die Frage nach dem Charakter des Krieges in der Ukraine kommt man nur näher, wenn man einerseits zwischen dem militärischen Krieg und dem „Wirtschaftskrieg“ und andererseits zwischen direkten und indirekten Teilnehmern unterscheidet. Was den militärisch ausgetragenen Krieg betrifft, haben wir zwei direkte Teilnehmer: Russland und die Ukraine. Die Zahl der indirekten Teilnehmer im Sinne von Waffenlieferungen und Ausbildung ist dagegen sehr viel größer und umfasst auf Seiten der Ukraine das gesamte Nato-plus-Spektrum bis hin zu Japan und Südkorea, die die Ukraine in der einen oder anderen Weise mit militärisch nutzbaren Gütern unterstützen. Wichtigster politischer Verbündeter Russlands ist China („grenzenlose Freundschaft“), das aber bisher, soweit erkennbar, keine militärische Unterstützung leistet.