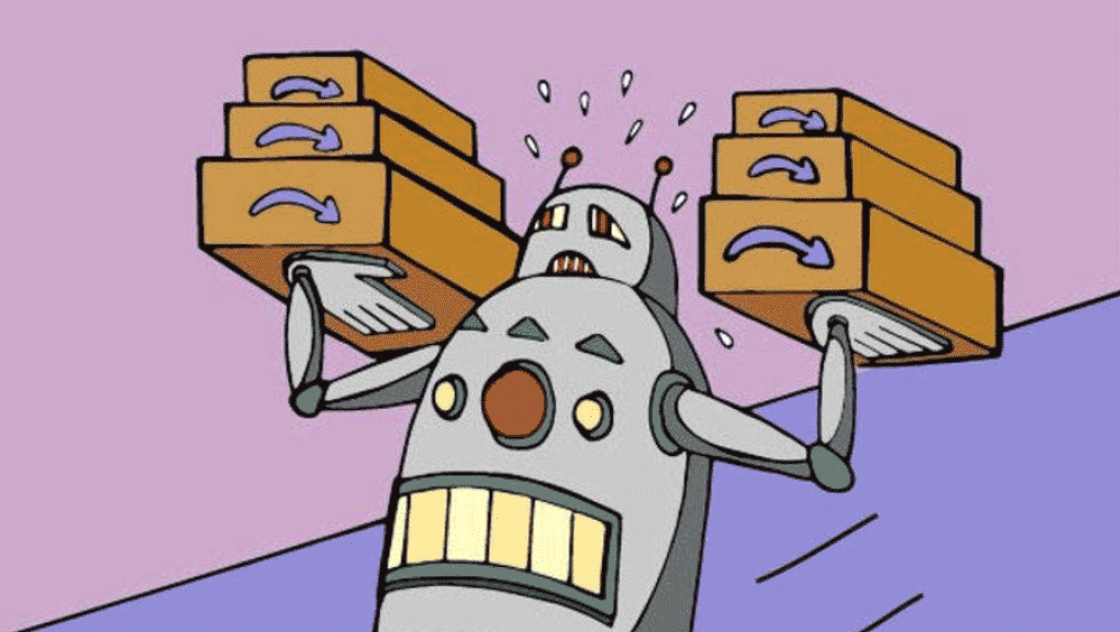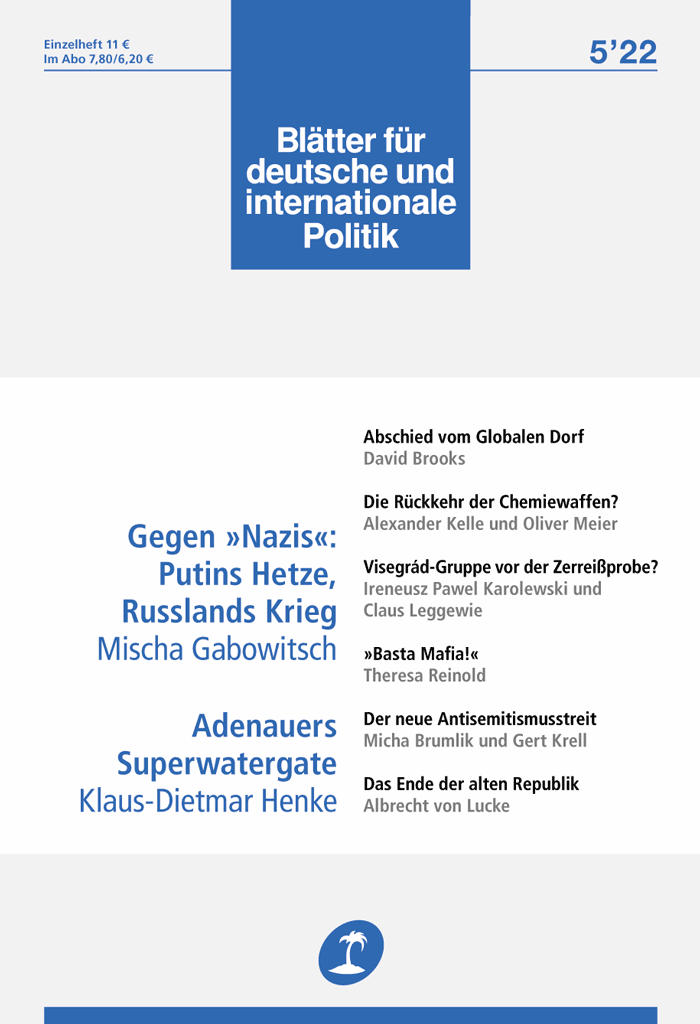Es ist ein historisches Ereignis, so jedenfalls will es die Berichterstattung: Der „wichtigste erfolgreiche Arbeitskampf seit den 1930er Jahren“ hieß es etwa im Magazin „Jacobin“, nachdem eine neue Gewerkschaft am 1. April eine Vertretungswahl beim Amazon-Lagerhaus JFK8 in Staten Island, New York, deutlich gewann. Das Unternehmen hat ungefähr 538 US-Dollar pro Beschäftigtem ausgegeben, um diese erste gewerkschaftliche Vertretung an einem Amazon-Standort in den USA zu verhindern. Teilte man in der Konzernzentrale also die mediale Wahrnehmung, dass dies „potentiell einer der größten Gewerkschaftserfolge seit den 1930er Jahren“ („The New Yorker“) ist? Eher nicht, kostspielige anti-gewerkschaftliche Kampagnen sind schlicht Routine.
Die Auseinandersetzung erinnerte an den Kampf zwischen David und Goliath. Auf der einen Seite der weltumspannende Konzern, dessen über 200-Milliarden-US-Dollar-schwerer Gründer Jeff Bezos mit Reiseplänen Richtung Mars protzt, während die Amazon-Fahrer sich aus Zeitnot in Flaschen erleichtern müssen. Auf der anderen Seite die kleine Amazon Labor Union (ALU), deren Mitgründer und Interimspräsident ein ziemlich ungewöhnlicher Gewerkschaftsaktivist ist: Der zwei Jahre zuvor wegen seines Eintretens für mehr Gesundheitsschutz entlassene ehemalige Lagerarbeiter Chris Smalls tritt gewöhnlich im Rapper-Outfit auf – durchaus konsequent, weil der 34jährige Afro-Amerikaner tatsächlich früher ein Rapper war.
Weil Amazon mit seinem für weltweit 1,6 Millionen Beschäftigte brutalen Geschäftsmodell so prägend für den gegenwärtigen Kapitalismus ist und sich schon so viele Gewerkschaften an diesem Giganten die Zähne ausgebissen haben, darf man durchaus mit dem ehemaligen US-Arbeitsminister Robert Reich hoffen, dass der Sieg der ALU „den Beginn einer Erneuerung der Arbeitermacht in Amerika“ darstellt. Denn Smalls und seine Mitstreiter repräsentieren eine Generation junger, unterbezahlter und gestresster Beschäftigter, die nicht daran denken, sich von boomenden Konzernen wie Amazon weiterhin respektlos behandeln zu lassen.
Die gewonnene Anerkennungswahl bei Amazon – in den USA muss eine Mehrheit der Beschäftigten für die Vertretung ihrer Belange durch eine Gewerkschaft stimmen – ist tatsächlich Teil einer Welle gewerkschaftlicher Organisierung. Es gab in jüngerer Zeit bereits Organisierungserfolge bei Starbucks-Filialen, beim Outdoor-Geschäft REI, bei Brauereien, an Universitäten, Schulen und Museen, bei der „New York Times“ und anderen Zeitungen. Viele weitere Wahlen sind beantragt, was die verantwortliche, aber unterfinanzierte und personell unterausgestattete Behörde, das National Labor Relations Board (NLRB), stark unter Druck setzt – nicht zuletzt, weil das NLRB auch für Arbeitsrechtsverstöße zuständig ist, beispielsweise bei Entlassungen von Gewerkschaftsaktivisten. Auch Schließungen werden zur Abwehr von gewerkschaftlicher Organisierung von der Arbeitgeberseite regelmäßig ins Spiel gebracht, obwohl die explizite Drohung verboten ist.
»Do it yourself«-Gewerkschaften
Viele Analysen der aktuellen Organisierungswelle heben zu Recht einige neue Aspekte hervor: Statt von etablierten Gewerkschaften geht die Initiative meist von den Beschäftigten selbst aus. Diese sind oft jung und divers, und die von ihnen gegründeten Organisationen erkämpfen mit ihren Aktionen auch Verbesserungen unterhalb der Schwelle gewerkschaftlicher Organisierung, das heißt ohne Anerkennungswahl und Tarifvertrag. Dieser „solidarity unionism“ von Basis-Initiativen löst deshalb große Begeisterung auf der betriebssyndikalistisch geprägten Gewerkschaftslinken in den USA aus, die traditionell Vorbehalte gegen bürokratische Gewerkschaften hat. Von den Initiativen junger, diverser Belegschaften und den Organisierungserfolgen in kleinen Betrieben erhofft man sich eine Signalwirkung an die jüngsten Generationen von Beschäftigten. Umfragen zeigen, dass Gewerkschaften bei diesen einen guten Ruf haben und gar als „cool“ gelten, seit die soziale Ungleichheit im Zuge der Occupy-Wall-Street-Proteste wieder auf der politischen Tagesordnung ist.
In Staten Island hat die Tatsache, dass die ALU eine Graswurzelinitiative von aktuellen wie ehemaligen Amazon-Beschäftigten ist, konkret bei der Organisierung geholfen, denn diese konnte nicht als betriebsfremde „dritte Partei“ diffamiert werden. Dies ist eine übliche Strategie anti-gewerkschaftlicher Berater, erfolgreich eingesetzt beispielsweise gegen die Retail, Wholesale and Department Store Union (RWDSU) bei einem Amazon-Standort in Bessemer, Alabama. Die Wahl dort ging verloren und die gerichtlich erzwungene Wiederholungswahl vermutlich auch. Noch wichtiger: Während hauptamtliche Gewerkschaftssekretäre gewöhnlich keinen Zugang zum Betriebsgelände bekommen, um Beschäftigte anzusprechen und für die Gewerkschaft zu werben, hatte sich Amazon nach einer gerichtlichen Einigung dazu verpflichtet, seinen Beschäftigten außerhalb ihrer Arbeitszeit gewerkschaftliche Betätigung im Betrieb zu erlauben. Die Aktivisten der ALU nutzten dies unter anderem dazu, die berüchtigten „captive audience meetings“ zu unterlaufen. An diesen während der Arbeitszeit durchgeführten anti-gewerkschaftlichen Unterrichtungen müssen die Beschäftigten teilnehmen, oft in Anwesenheit ihrer Vorgesetzten. Diese Veranstaltungen – geschützt durch die „Meinungsfreiheit“ des Arbeitgebers – dienen der Verbreitung gewerkschaftsfeindlicher Klischees und Falschinformationen sowie der Einschüchterung. Doch im Fall der ALU gelang dies nicht: Gut vorbereitete und freundliche ALU-Vertreter nahmen regelmäßig teil, auch ungebeten, und vertraten den Standpunkt der Gewerkschaft.
Die ALU-Aktivisten waren überdies ähnlich divers wie die Belegschaft, weshalb es ihnen gelang, die verschiedenen Gruppen im Betrieb gezielt anzusprechen. Darüber konnten sie in Kommunikationsnetzwerke eingebunden und über gewerkschaftliche Aktivitäten und Falschinformationen des Unternehmens informiert werden. Vor allem aber avancierten interessierte Beschäftigte schnell selbst zu Aktivisten. Das war wegen der bei Amazon schon vor der Pandemie hohen Fluktuation der Belegschaft auch notwendig. Die ALU musste die Anerkennungswahl mit nur 30 Prozent Zustimmung beantragen, dem Minimum der notwendigen Stimmen. Üblicherweise versuchen Gewerkschaften dagegen, 60 oder 70 Prozent Unterstützung zu bekommen, um angesichts der meist wirkungsvollen anti-gewerkschaftlichen Kampagnen am Ende zumindest eine einfache Mehrheit zu erreichen. In Staten Island war Amazon mit einer solchen Kampagne nicht erfolgreich. Trotz der hohen Fluktuation konnte die ALU mit über zehn Prozent Vorsprung gewinnen – ein bemerkenswerter Erfolg.
Und dennoch: Trotz der eindrucksvoll gewonnenen Abstimmung ist ein nüchterner Blick auf ihre Voraussetzungen wie auf ihre Konsequenzen ratsam – zumal Amazon die Wahl noch anfechten kann.
Was die erhoffte Renaissance der US-Gewerkschaften anbelangt, sind die Zahlen nach wie vor ernüchternd: Zwar ist der jetzt organisierte Amazon-Standort mit mehr als 8300 Beschäftigten kein kleiner Betrieb – jedenfalls größer als Starbucks-Filialen mit ihren meist nur etwa 25 Beschäftigten. Aber selbst die geschwächten US-Gewerkschaften – nur knapp über zehn Prozent der Amerikaner sind Gewerkschaftsmitglieder, in der Privatwirtschaft sogar nur knapp über sechs Prozent – repräsentieren insgesamt immer noch 16 Millionen Beschäftigte. Für die ALU in Staten Island stimmten gerade einmal 2654 Menschen, bei 2131 Gegenstimmen. Das ist selbstverständlich zu wenig, um wirklich von einer Welle sprechen zu können, auch wenn man hoffen kann, dass der Erfolg Beschäftigte wie etablierte Gewerkschaften inspiriert.
Zweite Halbzeit
Die Auseinandersetzung mit Amazon am Standort Staten Island ist jedenfalls beileibe noch nicht vorüber. Zwar wird das Unternehmen das Lager vermutlich nicht einfach schließen, um die Gewerkschaft wieder loszuwerden. Denn Amazons Geschäftsmodell ist von der Nähe zu den Endkunden abhängig und so einfach sind in New York die notwendigen freien Flächen schlicht nicht zu finden. Aber Amazon kann und wird die Verhandlung eines Tarifvertrags verzögern, so lange es geht – ganz abgesehen von möglichen Klagen gegen die Abstimmung und der geplanten Verbannung bestimmter Begriffe aus der Belegschafts-Chat-App (wie „Gewerkschaft“, „Entlohnung“, Vielfalt“ oder „Ungerechtigkeit“).
Doch erst der Abschluss eines Tarifvertrags begründet das Recht der Gewerkschaft, Mitgliedsbeiträge einzuziehen. Dies wird vermutlich Jahre dauern und damit steht die ALU vor einem gewaltigen Finanzierungsproblem. Bei der Organisierung hat ohne Zweifel geholfen, dass sie von Amazon-Beschäftigten selbst getragen ist. Doch die Unabhängigkeit gerät zum Nachteil, wenn die Ressourcen fehlen, um bis zum Abschluss eines Tarifvertrages durchzuhalten. Tatsächlich war die ALU auch in der Organisierungsphase stark von externen Unterstützern abhängig. Neben GoFundMe-Spendenkampagnen gab es Stipendien des Solidarity Fund für Aktivisten sowie kostenlose anwaltliche und technische Hilfe sowie Büroräume von etablierten Gewerkschaften.
Die Frage des Durchhaltens stellt sich auch auf andere Weise. Die vielen Unterstützer der Gewerkschaft im Betrieb haben über Monate ein hohes Maß an unbezahltem Engagement gezeigt. In Interviews sprechen die Aktivisten von den „Opfern“, die sie gebracht haben, um sieben Tage in der Woche, 24 Stunden am Tag, ansprechbar zu sein. Doch der Sieg ist unvollständig; es geht im Prinzip einfach nur in die zweite Halbzeit des Spiels. Die Strategen basisgewerkschaftlicher Ansätze raten dazu, die Tarifvertragskampagne wie eine Organisierungskampagne durchzuführen, also wiederum mit breiter Beteiligung der Belegschaft.[1] Werden die Aktivisten aber noch einmal über Monate oder gar Jahre den Druck auf das Unternehmen aufrechterhalten können? Zumal sicherlich einige von ihnen Amazon verlassen werden, ob freiwillig oder gekündigt. Amazon wird dagegen weiter agitieren, beispielsweise mit der – in New York zutreffenden – Information, dass nach Abschluss eines Tarifvertrags auch diejenigen für die Vertretung durch die Gewerkschaft bezahlen müssen, die nicht Gewerkschaftsmitglied werden wollen. Es ist daher nicht unwahrscheinlich, dass die Unterstützung bröckelt.
Tatsächlich ist das Problem für die ALU noch größer, denn sie muss weitere Standorte organisieren, um den notwendigen Druck für den Abschluss eines guten Vertrags aufzubauen. Amazons Geschäftsmodell stellt sicher, dass pünktliche Lieferungen von verschiedenen Lagern aus erfolgen können – das erfährt auch hierzulande die Gewerkschaft Verdi regelmäßig, wenn Streiks bei deutschen Standorten nicht verhindern, dass die Kunden aus Polen beliefert werden. Ende April steht eine ALU-Anerkennungswahl an einem Nachbarstandort in New York an, mit ungewissem Ausgang.
Wenn freiwillige Beiträge und Spenden nicht ausreichen, muss sich die ALU also womöglich doch noch einer größeren Gewerkschaft anschließen. Es gibt durchaus gute Gründe dafür, warum diese bürokratisch organisiert sind, mit professionellem Personal arbeiten und finanzielle Reserven bereithalten. So haben sich die Workers United-Initiativen bei Starbucks bereits der Dienstleistungsgewerkschaft SEIU angeschlossen. Auf der anderen Seite geht dann im Betrieb vielleicht der diskursive Vorteil verloren, kein „Außenseiter“ zu sein.
Angesichts des langen Atems, den die ALU bis zum Abschluss eines Tarifvertrages mutmaßlich brauchen wird, werden sich für Amazon weitere Möglichkeiten ergeben, der gewerkschaftlichen Organisierung das Wasser abzugraben. Und wenn der Knüppel – also die Bekämpfung der Organisierung durch anti-gewerkschaftliche Berater – nicht funktioniert, gibt es immer noch die Karotte. Amazon kann den Beschäftigten bei Löhnen und Arbeitsbedingungen „freiwillig“ entgegenkommen und sich sozusagen als guter Arbeitgeber inszenieren. Angesichts von Arbeitskräftemangel, Inflationsdruck und Rekordgewinnen ist die Verhandlungsmacht der Beschäftigten ja ohnehin gestiegen. Das gibt dann wiederum dem Argument Auftrieb, dass man angesichts besserer Bedingungen einen „Außenseiter“ – der zudem auch noch Beiträge verlangt – nun wirklich nicht braucht. Bereits ein Jahr nach der Anerkennungswahl kann das Unternehmen zudem eine Aberkennungswahl beantragen.
Für die erhoffte „Renaissance der Gewerkschaften“, sprich: eine wirklich nachhaltige Organisierungswelle, wird daher mehr notwendig sein als Basis-Aktivismus. Auch wenn die Kritik an der bürokratischen Verkrustung der etablierten Gewerkschaften berechtigt ist, sind nur sie derzeit zu den erforderlichen größeren Kampagnen in der Lage, die über einzelne Standorte von Unternehmen hinausgehen.
Auf der anderen Seite scheinen die etablierten Gewerkschaften die Bedeutung der neuen Initiativen zu erkennen. „Wir müssen von den Beschäftigten angetrieben werden“, sagt Mark Dimondstein von der American Postal Workers Union. Und Sean O‘Brian, neugewählter Präsident der Transport- und Lagerarbeitergewerkschaft Teamsters hat sich zur Kooperation bereit erklärt. Am Ende führt ja vielleicht ein hybrider Ansatz zum nachhaltigen Erfolg, also unabhängige Basis-Organisationen mit Unterstützung durch die großen Gewerkschaften.[2]
Vom Staat haben die Gewerkschaften jedenfalls wenig zu erwarten, trotz eines gewerkschaftsfreundlichen Präsidenten. Das von der Gewerkschaftslinken kritisierte politische Engagement bleibt somit weiter notwendig, zumal nun die US-Demokratie selbst auf dem Spiel steht.