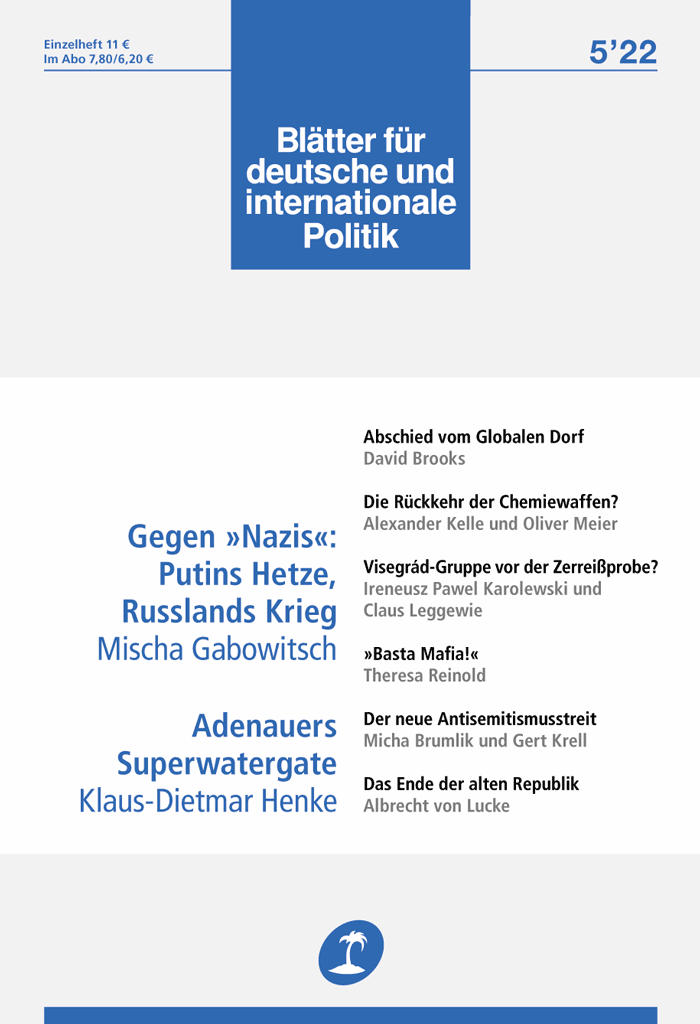Bild: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskyy während eines Treffens in Kiew, 8.4.2022 (IMAGO / ZUMA Press)
In Reaktion auf den Ukraine-Krieg forderten in den April-»Blättern« Wolfgang Zellner und Albrecht von Lucke eine Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit. Dem widerspricht der Politikwissenschaftler Manuel Müller: Die geopolitische Wende der EU gefährde ihren traditionell weltoffenen Charakter.
Wenig vereint so sehr wie ein gemeinsamer Feind. Auch der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat in der Europäischen Union eine plötzliche, ungeahnte Entschlossenheit zum gemeinsamen Handeln ausgelöst. Innerhalb weniger Tage gelang es den Regierungen, sich auf Sanktionen gegen Russland und Belarus zu einigen, Hilfspakete für die Ukraine zu schnüren und sogar EU-finanzierte Waffenlieferungen zu organisieren. Es war der vorläufige Höhepunkt einer länger andauernden Wandlung im Selbstverständnis der EU: War die europäische Einigung früher vor allem ein nach innen gerichteter Prozess, sieht sich die EU zunehmend als geopolitischer Block, der sich auf einer Weltbühne voller Bedrohungen behaupten muss. Und statt sich primär auf die soft power ihrer kompromissorientierten Kultur, ihrer demokratischen Werte und ihres attraktiven Marktes zu verlassen, setzt sie vermehrt auf militärische Stärke und Abschreckung.