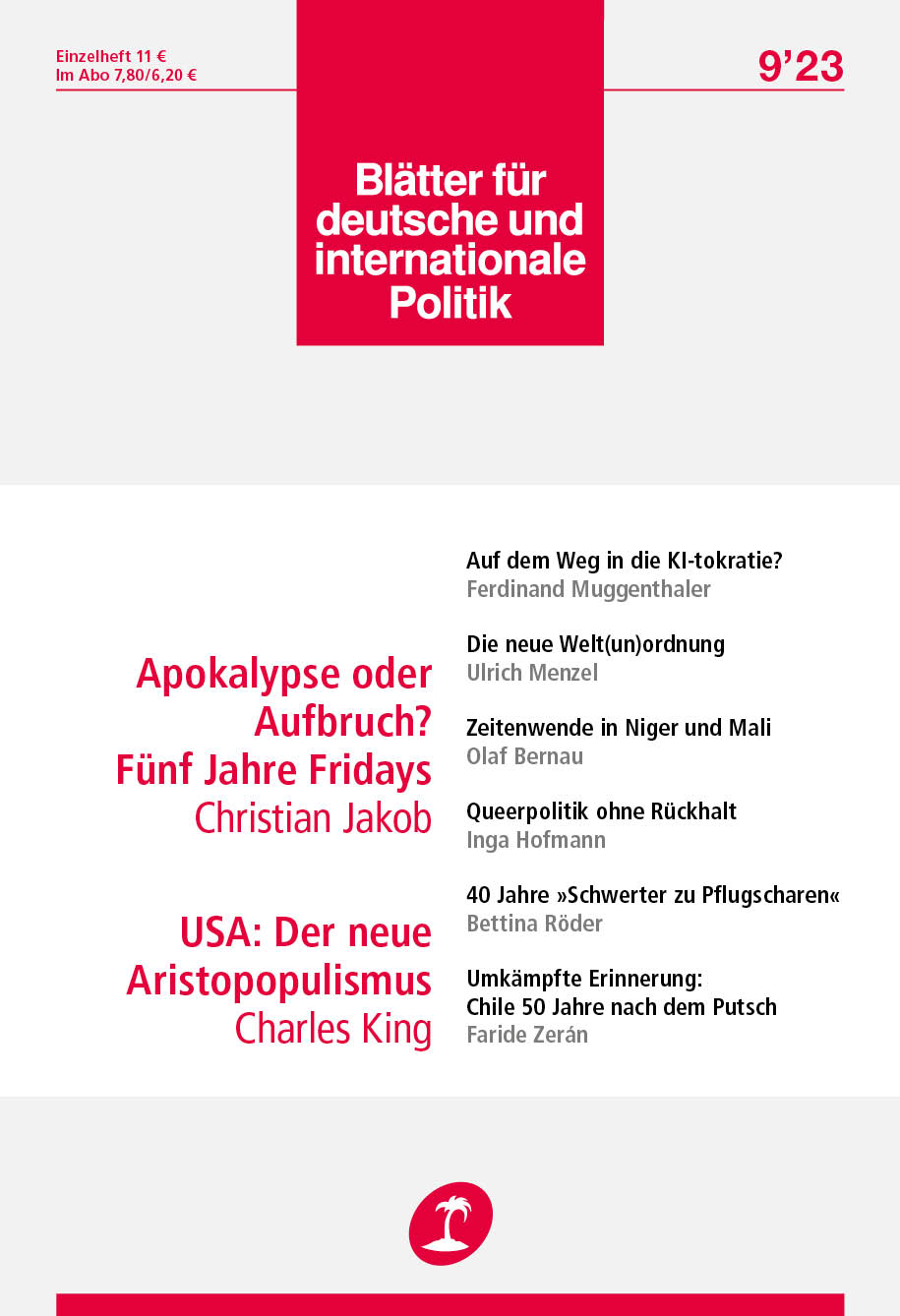Warum wir die Internationalen Beziehungen neu denken müssen

Bild: Von links nach rechts: Der brasilianische Präsident Luiz Inacio Lula da Silva, der chinesische Präsident Xi Jinping, der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa, der indische Premierminister Narendra Modi und der russische Außenminister Sergej Lawrow beim 15. BRICS-Gipfel in Johannesburg, 23.8.2023 (IMAGO / ZUMA Wire)
Gut eineinhalb Jahre nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine geht es längst nicht mehr „nur“ um eine militärische Auseinandersetzung, sondern auch um die Gestaltung – oder das Erleiden – einer neuen politischen wie ökonomischen Welt(un)ordnung.
Die Spirale gegenseitiger Boykotte hat demonstriert, dass außenhandels- und insbesondere rohstoffabhängige Länder wie Deutschland dabei besonders verletzlich sind. Die USA mit ihrem großen Binnenmarkt und einer nahezu kompletten Ausstattung mit natürlichen Ressourcen tun sich dagegen leichter, andere mit Sanktionen zu belegen. In Ländern wie Deutschland sind Boykotte ein zweischneidiges Schwert, da sie beide Seiten treffen. Energie- und Inflationskrise waren und sind hierzulande die Folgen – und die Folge der Folgen ist, dass die Populisten, denen nach Abschwächung der Flüchtlingskrise und der Coronakrise das zentrale Mobilisierungsthema ausgegangen war, ein neues gefunden haben. Heute finden sich Putin-Versteher nicht nur unter den Rechten, sondern auch im Wagenknecht-Lager. Wieder werden die westlichen Regierungen von außen und innen in die Zange genommen, müssen sie bei ihrer Unterstützung der Ukraine nicht nur eine mögliche Eskalation des Krieges bedenken, sondern auch die Folgen für die heimische Wirtschaft und den sozialen Frieden im Lande.
Seit Putins Drohung steht zudem die fast schon vergessene nukleare Abschreckung wieder auf der Tagesordnung.