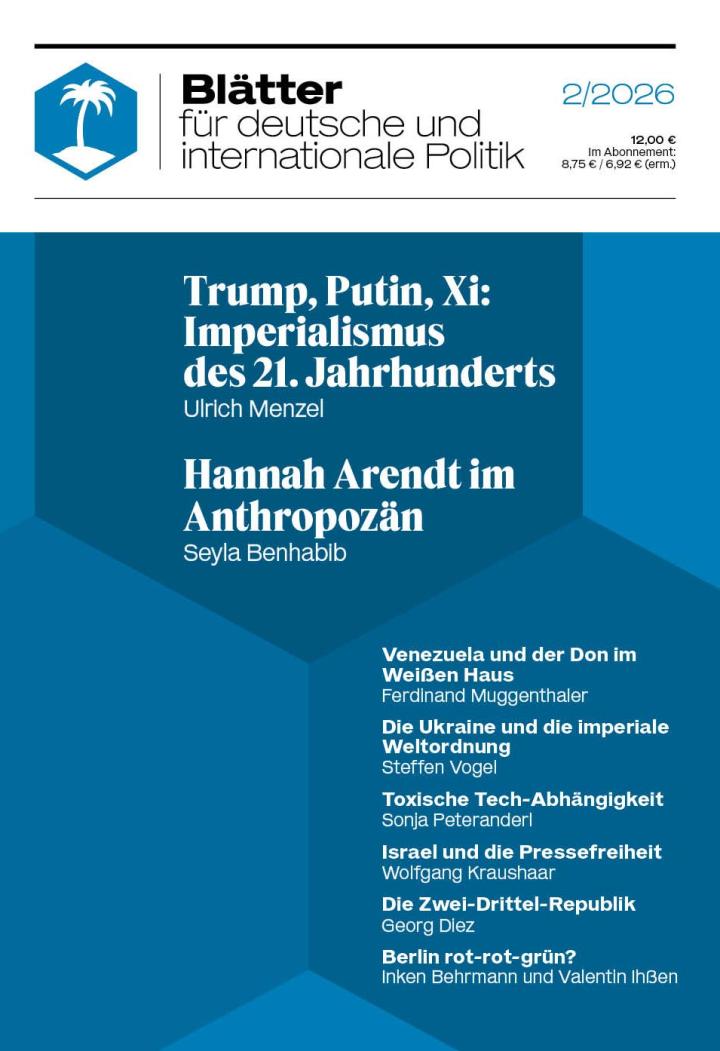Nicht einmal ein Viertel seiner regulären Laufzeit überstand das letzte Parlamentsmandat für den Einsatz der Bundeswehr am Hindukusch. Seit dem 26. Februar gilt ein revidierter Auftrag. Er holt nach, was in den meisten Partnerländern bereits vollzogen wurde: die Anpassung an den von Washington verordneten Strategiewechsel.
Die dreistufige Entscheidungsbildung folgte vertrauten Mustern. Mit einem Fanfarenstoß eröffnete sie Präsident Obama am 1. Dezember vergangenen Jahres. In seiner Rede an der Militärakademie West Point verkündete er, das amerikanische Truppenkontingent nochmals drastisch um 30 000 Einsatzkräfte aufzustocken. Für das Vorhaben fungierte die Londoner Afghanistan-Konferenz vom 28. Januar als internationaler Akklamationsverstärker. An blumigen Selbstverpflichtungen zu mehr Engagement und größeren Anstrengungen ließ es kein Teilnehmer fehlen. Um die Details der Ausführung kümmern sich inzwischen die nationalen Kanzleien. Dazu gehört auch das vorfristig erneuerte Bundestagsmandat.
Auf allen drei Entscheidungsebenen weisen die jüngsten Beschlüsse eine Gemeinsamkeit auf: Sie werden mit einer Ausstiegsperspektive begründet. Das ist neu und verleiht der internationalen Afghanistan-Debatte eine ungewohnte Dimension. Bisher war es verpönt, die Frage nach der Exitstrategie auch nur aufzuwerfen. Wer sich nicht dem Verdacht aussetzen wollte, vor terroristischer Gewalt zu kapitulieren, nahm das Unwort erst gar nicht in den Mund.