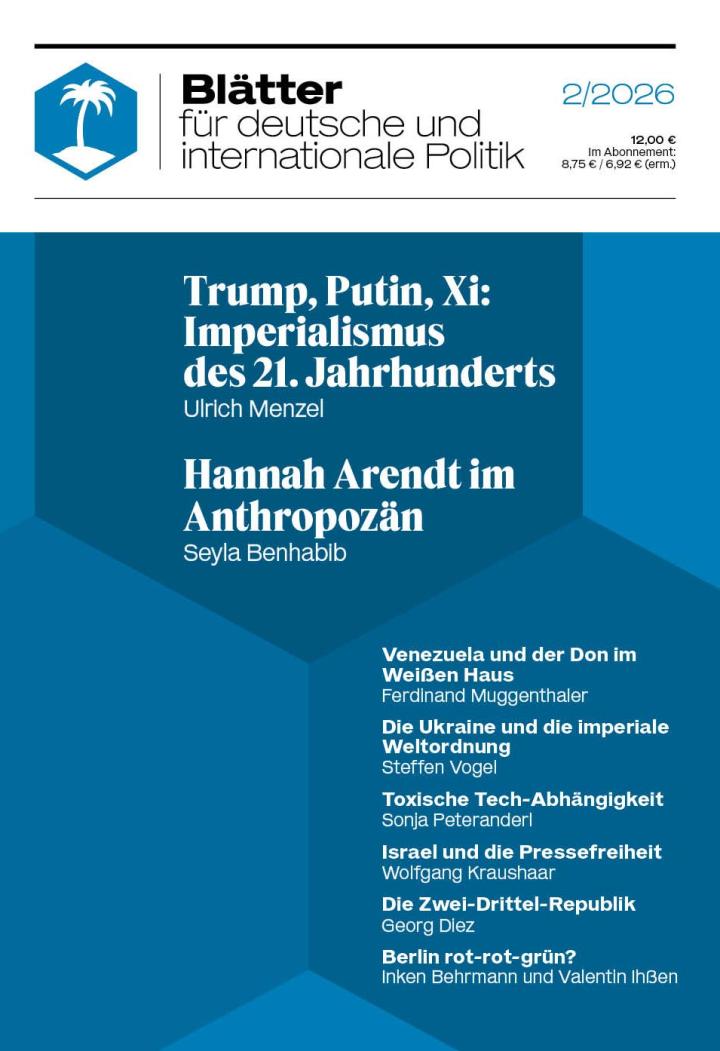Kaum eine erste Zeitungsseite, kaum ein TV-Sender, kaum eine Radiosendung, die nach dem Pariser Anschlag auf den Slogan „Wir alle sind Charlie“ verzichten wollte. Die zwölf in Paris Ermordeten der Zeitung „Charlie Hebdo“ erfuhren Zuwendung und Trauer in aller Welt. Staatsoberhäupter kondolierten, Prominente gaben kund, Journalisten kommentierten: „Wir alle sind Charlie“.
Darf man die Zahl der Toten vergleichen? Jene mehr als eine Million Muslime, die als Folge der US-Invasion in den Irak umgebracht wurden, jene mehr als 40 000 afghanischen Zivilisten, die dem „Krieg gegen den Terror“ zum Opfer gefallen sind, jene etwa 50 000 Libyer, die auf dem Altar der Nato-Intervention verbrannt wurden, jene ungefähr 3000 Toten im Resultat amerikanischer Drohnen-Hinrichtungen in Pakistan – darf man diese mit den zwölf Toten in Paris vergleichen? Nein, das darf man nicht. Denn jeder Tote ist einer zu viel.
Was man allerdings vergleichen darf, ist das Maß an Trauer, an Mitleid, an Interesse, den diese oder jene Tote auslösen. Die zumeist muslimischen Toten in den Kriegen des Westens in der islamisch geprägten Welt haben kein Gesicht, sie sind Statistik, Kollateralschäden am Wegesrand amerikanischer Geopolitik. Es sind ja auch so viele, wie sollte man da den einzelnen würdigen, selbst wenn man denn wollte. Aber man will auch nicht.