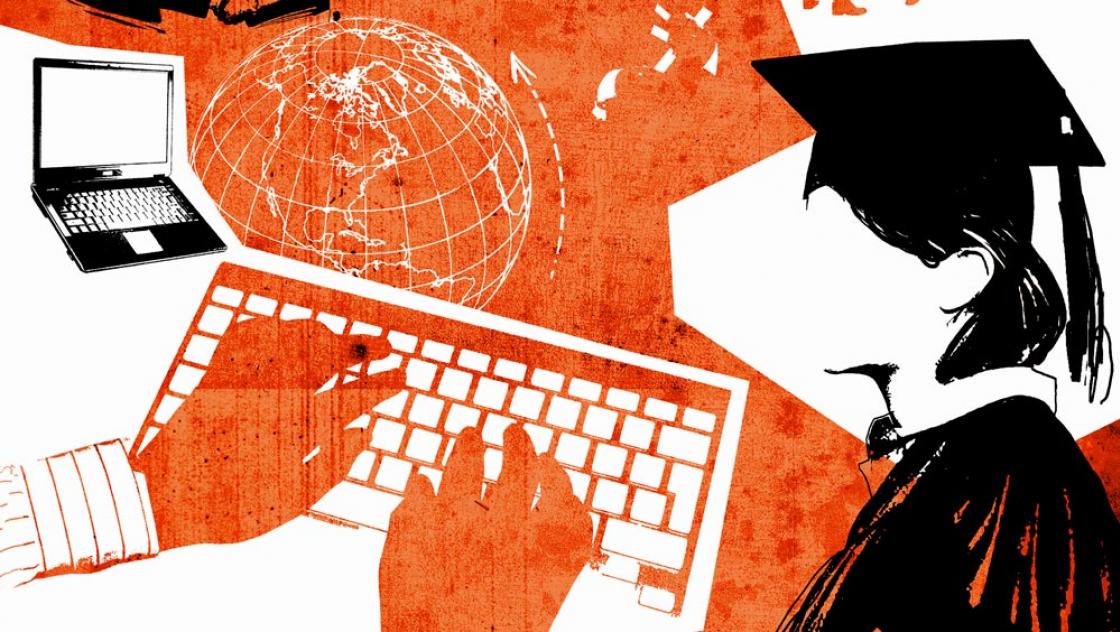
Bild: IMAGO / Ikon Images
Endlich sind prekäre Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft im Fokus der breiteren Öffentlichkeit angekommen. Ausgangspunkt war der von uns Anfang Juni initiierte Twitter-Hashtag #IchBinHanna.[1] Er geht zurück auf ein inzwischen gelöschtes Erklärvideo des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG), in dessen Zentrum eine animierte Figur namens Hanna steht.[2] Die fiktive Hanna stellt eine Wissenschaftlerin dar, die sich laut Video noch qualifiziert und deshalb einen befristeten Vertrag nach dem anderen bekommen darf, bis die zwölf Jahre Höchstbefristungsdauer des WissZeitVG (sechs Jahre vor, sechs Jahre nach der Promotion) aufgebraucht sind. Diese fast schon zynische Sichtweise hat Tausende von Wissenschaftler*innen in den sozialen Medien dazu veranlasst, die gravierenden Missstände des deutschen Wissenschaftssystems anhand persönlicher Geschichten offenzulegen.
Dank der Sonderbefristungsregelung und der starken Ausrichtung auf kurzfristige Projektgelder gibt es an deutschen Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen kaum noch unbefristet angestelltes wissenschaftliches Personal – mit Ausnahme der auf Lebenszeit verbeamteten W2- und W3-Professuren, die inzwischen aber nur noch 13 Prozent aller wissenschaftlich Beschäftigten ausmachen. Insgesamt liegt die Befristungsquote mittlerweile bei 78 Prozent, bei den unter 45jährigen sogar bei 92 Prozent[3] – in keinem anderen Beschäftigungszweig hierzulande finden sich derartige Zustände. Vielmehr sollte das Normalarbeitsverhältnis prinzipiell eine unbefristete Dauerstelle sein,[4] was die Befristungsquoten für den restlichen Arbeitsmarkt auch abbilden.[5]
Begründet wird die Sonderbefristung in der Regel damit, dass es sich bei der Wissenschaft um ein „besonderes Arbeitsumfeld“ handele, das mit anderen Formen der Erwerbsarbeit nicht vergleichbar sei. Hier spielt die immer wieder angeführte Argumentationsfigur, der zufolge nur stete Fluktuation in der Wissenschaft Innovation erzeuge, eine wesentliche Rolle. Zugleich halten es einige der an der Diskussion Beteiligten für akzeptabel, Menschen bis ins fünfte Lebensjahrzehnt als „Nachwuchs“ zu bezeichnen, der sich noch in der „Qualifikation“ befinde und folglich auch keinen Anspruch auf eine unbefristete Beschäftigung habe.
Dass wissenschaftlich Angestellte dauerbefristet sind, ist jedoch nur eines der vielen Probleme. Dank der strikten Regelungen des WissZeitVG müssen zahlreiche hochqualifizierte Akademiker*innen die Wissenschaft nach jahrelanger Berufserfahrung verlassen und sich beruflich neu orientieren. Als eine Begründung für die Höchstbefristungsdauer wurde immer wieder der Schutz der Arbeitnehmer*innen genannt, die danach entfristet werden sollten. Doch es ist schwer, eine der raren Professuren zu ergattern – und Hochschulverwaltungen suchen Entfristungen unter allen Umständen zu vermeiden, nicht zuletzt, weil man sich nicht langfristig finanziell binden will oder kann.
Prekäre Verhältnisse muss man sich leisten können
Bis Mitte 40 sind wissenschaftliche Erwerbsbiographien daher überwiegend von Umzügen, Pendeln und Phasen zwischenzeitlicher Arbeitslosigkeit geprägt.[6] Folglich wird nicht nur eine Familiengründung behindert, was vor allem Frauen vor die Alternative stellt, die Wissenschaft zu verlassen oder gegebenenfalls ungewollt kinderlos zu bleiben. Gleichzeitig ist die wissenschaftliche Laufbahn für Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen oder familiären Verpflichtungen, für die ständige Umzüge nicht zumutbar sind, mit massiven zusätzlichen Hürden verbunden.
Personen, die Einkommenseinbußen durch Teilzeitstellen und Vertragslücken nicht durch eigene Rücklagen überbrücken können oder deren Aufenthaltsgenehmigung vom Arbeitsvertrag abhängt, werden systematisch benachteiligt und sind entsprechend in der deutschen Wissenschaft eindeutig unterrepräsentiert. Insofern ist es ausgesprochen zynisch, dass das zuständige Ministerium die aktuelle Befristungspraxis mit Chancengerechtigkeit zu rechtfertigen sucht: Nicht eine Generation, heißt es im Hanna-Video, solle das „System“ verstopfen, allen solle der Weg zur wissenschaftlichen Qualifikation offenstehen. Gemeint sein können damit aber nur jene, die sich derart prekäre Verhältnisse überhaupt leisten können.
Ineffiziente Häppchenforschung
Während für Studium und Promotion die Forderung nach einer gewissen Fluktuation zur Gewährleistung von (alle berücksichtigenden!) Teilhabechancen noch überzeugen mag, ist eine entsprechende Forderung mit Blick auf die Postdoc-Phase – also den Zeitraum nach dem Abschluss einer Doktorarbeit – hanebüchen. Dass eine Generation einer anderen Platz machen muss, damit alle in den „Genuss“ jahrelanger Unsicherheit und Zwangsteilzeit kommen können, hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Hier geht es vielmehr darum, eine möglichst preisgünstige Masse an willigen Arbeitnehmer*innen zu erhalten, die sich aufgrund ihrer prekären Lage kaum organisieren können und aus Angst, keine Vertragsverlängerung zu bekommen, nicht auf der Einhaltung der ihnen zustehenden Arbeitsrechte bestehen. Wissenschaftler*innen leisten im Durchschnitt (!) 13 bzw. 10 Stunden unbezahlte Mehrarbeit pro Woche (vor bzw. nach der Promotion),[7] was sich im Jahr auf rund 12 Wochen zusätzliche Arbeitsleistung summiert, von der die Hochschulen unentgeltlich profitieren. Urlaubstage verfallen oder werden nur auf dem Papier genommen, während man selbstverständlich weiterarbeitet und natürlich per E-Mail erreichbar bleibt.
Das derzeitige System schadet der Wissenschaft als Ganzes sowie der Qualität des Studiums in Deutschland. Personen, die ständig um den nächsten Vertrag bangen oder Gelder für ihre Stelle erst über aufwändige Drittmittelanträge selbst einwerben müssen, betreiben kaum innovative, ergebnisoffene und riskante Forschung. Sie forschen vielmehr zu Themen, von denen sie annehmen, dass Vorgesetzte und Gutachter*innen diese für förderungswürdig halten. Da alle von Drittmitteln abhängen – die Grundfinanzierung an den Hochschulen beträgt inzwischen nur noch 50 Prozent[8] – und der Normalbetrieb nur durch befristete Gelder überhaupt aufrechtzuerhalten ist, werden immer mehr Anträge gestellt, während die Bewilligungsquote notwendig sinkt. Es wird also sehr viel Aufwand in das Schreiben, Begutachten und Verwalten von Anträgen investiert, die am Ende zu nichts führen. Dies ist hochgradig ineffizient.
Das derzeitige System schadet der Wissenschaft als Ganzes sowie der Qualität des Studiums in Deutschland.
Darüber hinaus zwingt das Drittmittelwesen Forscher*innen dazu, ihre Forschung projektförmig zu organisieren und in Häppchen von maximal drei Jahren zu zerlegen. Nur: Grundlagenforschung braucht deutlich länger und fällt dadurch zunehmend weg. Zudem entstehen aus der Projektforschung Folgekosten, die aber niemand tragen will. So stehen an vielen deutschen Hochschulen teuerste Gerätschaften, die keiner mehr bedienen kann, weil das kompetente Personal längst weiterziehen musste; mühsam aufgebaute Webpräsenzen und Datenbanken werden nach Ende der Förderzeit nicht mehr gepflegt oder gehen wieder vom Netz. Nachhaltige Forschung sieht anders aus.
Nicht zuletzt ist der Schaden auch für die Lehre an den Hochschulen immens. Lehre sollte den neuesten Stand der Forschung vermitteln. Dies ist nicht gewährleistet, wenn Lehrenden die Zeit fehlt, diesen überhaupt noch zur Kenntnis zu nehmen. Durch den anhaltenden Personalwechsel finden Studierende kaum kompetente und verlässliche Ansprechpartner*innen an deutschen Hochschulen. Abschlussarbeiten können mangels Anschlussbeschäftigung oft nicht betreut werden. Dauerüberarbeitung und der kontinuierliche Zwang zum Schreiben von Bewerbungen und Anträgen zwingen Lehrende dazu, die Lehre zugunsten anderer Dinge zurückzustellen.
Paradoxien der Politik
All diese Missstände sind schon lange bekannt.[9] Erst die Aktion #IchBinHanna hat jedoch echten Druck auf die Politik ausgeübt. Das dokumentieren die Reaktionen des Bildungsministeriums, das zwar nicht müde wird zu betonen, es sei nicht zuständig, dann aber doch immer wieder die derzeitige Gesetzgebung als sinnvoll verteidigt. Dies jedenfalls war die Begründung, die das Ministerium als erste Reaktion auf #IchbinHanna in Form eines anonymen Textes auf seiner Homepage veröffentlichte.[10] Die Videobotschaft von Staatssekretär Wolf-Dieter Lukas vom 17. Juni 2021 läuft auf dasselbe Ergebnis hinaus, wie auch die Verlautbarungen von Ministerin Anja Karliczek und ihren Unionskolleg*innen in der Aktuellen Stunde zum Thema eine Woche später im Bundestag: Man äußert Verständnis für die „zum Teil schwierige[n] Situationen“ der Betroffenen, wirbt aber einmal mehr um Verständnis für die gegenwärtige Gesetzeslage.[11] Das WissZeitVG – laut Karliczek der „Sündenbock“ in der Debatte – sei ja „genau dazu da: Es zielt nämlich darauf, Dauerbefristungen zu verhindern. Es begrenzt die Zeit, in der sich junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf befristeten Stellen qualifizieren“, so Karliczek in ihrer Rede im Bundestag.
Hat die Ministerin also zunächst das Gesetz damit verteidigt, es solle Befristung begrenzen, wird es im unmittelbar folgenden Satz in einem krassen logischen Bruch dafür gelobt, dass es Befristung ermöglicht: „Wären diese Stellen nicht befristet, bekämen deutlich weniger qualifizierte junge Menschen die Chance, sich weiter zu qualifizieren, und viel weniger könnten zeigen, was sie können.“ – Was will man denn nun: mehr oder weniger Befristung?! Wie kann dieselbe Politik mit zwei einander diametral entgegengesetzten Argumenten gerechtfertigt werden?
Derartige Paradoxien sind bei der Bundesforschungsministerin besonders offensichtlich, sie durchziehen aber auch die Stellungnahme von Staatssekretär Lukas und die Verlautbarungen der anderen Redner*innen der Unionsparteien in der Aktuellen Stunde vom 24. Juni 2021. Das zeigt vor allem eines: Hier wird der Status quo verteidigt. Die Argumente, mit denen das geschieht, überzeugen allerdings überhaupt nicht. Das Ministerium setzt auf die geradezu paternalistische Strategie, den Wissenschaftler*innen, die auf die augenscheinlichen Missstände hinweisen, die Zusammenhänge besser zu erklären, und wirbt um deren „Verständnis“.[12] Wie aber soll man etwas verstehen, was argumentativ völlig widersprüchlich ist?
Zudem zählt das Ministerium all die Pakte und Programme auf, mit denen bereits versucht werde, die Karriereperspektiven des wissenschaftlichen „Nachwuchses“ zu verbessern: von der Exzellenzstrategie über den „Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“ und das Tenure-Track-Programm[13] bis hin zum Pakt für Forschung und Innovation. All diese Programme zeigen, wie stark der Bund inzwischen nicht nur per Gesetzgebung, sondern auch auf finanzieller Ebene auf die Rahmenbedingungen des deutschen Wissenschaftssystems Einfluss nehmen kann – und es auch tut. Dennoch verweist der Bund in der aktuellen Debatte allein auf die einzelnen Wissenschaftsinstitutionen und Länder – und entzieht sich damit der eigenen Verantwortung.
Ein Umsteuern bei dieser weder nachhaltigen noch effizienten Bewirtschaftung der Hochschulen zum Schaden von Wissenschaftler*innen und Wissenschaft ist derzeit nicht in Sicht. Somit müssen Wissenschaftler*innen bis auf Weiteres einen Großteil ihrer Zeit und Arbeitskraft für die Beantragung von Geldern verschwenden, anstatt diese für ihre Kernarbeitsbereiche einzusetzen: Forschung, Lehre und Bildung.
[1] Vgl. die Dokumentation: Amrei Bahr, Kristin Eichhorn und Sebastian Kubon (Hg.), www.ichbinhanna.wordpress.com.
[2] Hier archiviert: https://web.archive.org/web/20210611145015/https:/www.bmbf.de/de/media-video-16944.html.
[3] Vgl. Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs 2021, www.buwin.de, S. 111.
[4] Vgl. Friedrun Domke, Das Befristungsrecht des wissenschaftlichen Personals an deutschen Hochschulen zwischen wissenschaftlicher Dynamik und sozialer Sicherheit, Eine Untersuchung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes, Baden-Baden 2020, S. 19-20.
[5] Tatsächlich lag die Befristungsquote 2019 laut Statistischem Bundesamt für alle Arbeitnehmer*innen in Deutschland bei lediglich 7,4 Prozent, www.destatis.de.
[6] Amrei Bahr, Kristin Eichhorn und Sebastian Kubon, Forschung auf ALG 1 und Hartz IV. Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz und seine Effekte als Gegenstand zeithistorischer Wissenschaftsgeschichte, www.zeitgeschichte-online.de, 10.6.2021; vgl. auch: Britta Ohm, Exzellente Entqualifizierung: Das neue akademische Prekariat, in: „Blätter“, 8/2016, S. 109-120.
[8] Felix Grigat, Universitäten zu 50% aus Projekt- und Drittmitteln finanziert, www.forschung-und-lehre.de, 15.4.2018.
[9] Vgl. 95 Thesen gegen das WissZeitVG, www.95vswisszeitvg.wordpress.com.
[10] BMBF, Stellungnahme: #IchbinHanna – Antwort des BMBF auf die Diskussion in den Sozialen Netzwerken, www.bmbf.de, 13.6.2021.
[11] Hier und im Folgenden: Deutscher Bundestag, Stenografischer Bericht, 236. Sitzung, Plenarprotokoll 19/236, 24.6.2021, S. 30623 und S. 30622.
[12] Vgl. #IchbinHanna – Antwort des BMBF auf die Diskussion in den Sozialen Netzwerken, Videobotschaft Lukas, www.bmbf.de, 17.6.2021.
[13] Vgl. Andreas Keller, Traumjob Wissenschaft?, in: „Blätter“, 11/2014, S. 29-32.









