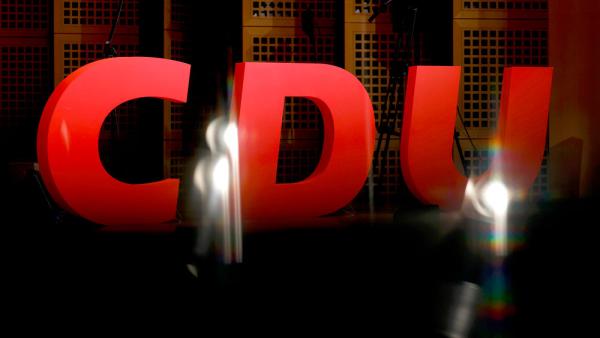Wilhelm von Humboldt und die Geburt der Diversität

Bild: Humboldt-Denkmal vor der Humboldt-Universität in Berlin (IMAGO / PEMAX)
Auch wenn Begriffe wie Biodiversität oder diversity management erst im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts geprägt wurden und seitdem den politischen Diskurs zur biologischen und sozialen Diversität bis in unsere Gegenwart hinein dominieren, verweist deren Vorgeschichte weit zurück bis ins 18. Jahrhundert – und sie ist unmittelbar mit einem revolutionären Ereignis verbunden, das wie kein anderes für die Entstehung der modernen Gesellschaft steht, nämlich mit der Französischen Revolution.
Nur wenige Jahre nach deren Ausbruch, im Januar 1792, veröffentlichte Wilhelm von Humboldt in der Berlinischen Monatsschrift einen kurzen Text mit dem Titel „Ideen über Staatsverfassung, durch die neue Französische Constitution veranlaßt“, der auf einem Brief an einen Freund aus dem August des vorhergehenden Jahres basierte und ihn zum Begründer einer neuen politischen Strömung machen sollte. Als das französische Feudalsystem durch die Nationalversammlung abgeschafft wurde, gehörte der junge Gelehrte wie so viele deutsche Philosophen und Dichter, von Hegel über Hölderlin bis Schiller, zu den interessierten, den Ereignissen im Nachbarland zugeneigten Beobachtern. Spätestens jedoch mit der Hinrichtung des französischen Königs am 21. Januar 1793 änderte sich die Stimmung unter den europäischen und speziell den deutschen Kommentatoren. Da die politischen Maßnahmen der Revolutionäre immer radikaler wurden, wuchs die Sorge vor weiteren Gewaltexzessen.