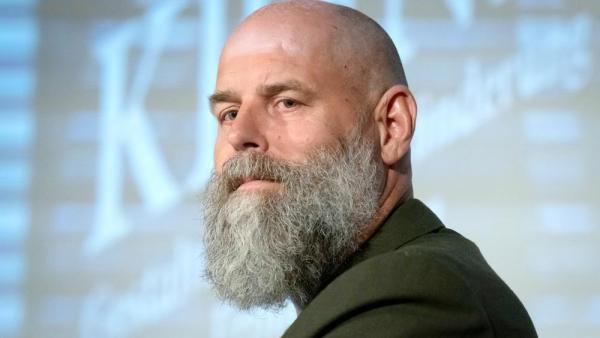Wie die Pressefreiheit weltweit attackiert wird

Bild: Ein palästinensischer Journalist vor den Trümmern des schwer beschädigten Al-Jawhara-Turms in Gaza-Stadt, 12.5.2021 (12.05.2021)
Die Verleihung des diesjährigen Friedensnobelpreises an die philippinische Journalistin Maria Ressa, Gründerin des investigativen Mediums „Rappler“, als auch an Dmitri Muratow, Redakteur der regierungskritischen russischen Zeitung „Nowaja Gaseta“, ist ein ungeheuer ermutigendes Zeichen – und ein dringend gebotenes. Denn in vielen Regionen der Welt sind Journalist*innen heute ihres Lebens nicht mehr sicher und brutaler Verfolgung ausgesetzt. Das gilt nicht zuletzt für Afghanistan, wo seit der neuerlichen Machtübernahme der Taliban hunderte Medien schließen und viele Medienschaffende das Land verlassen mussten, aus Sorge um ihr Leben und ihre Freiheit. Allerdings bildet die Lage am Hindukusch bloß die Spitze des Eisbergs, was die weltweit zunehmende Repression gegen Journalist*innen betrifft. Dabei hatte die UN-Vollversammlung bereits vor acht Jahren den 2. November als jährlichen Welttag gegen Straflosigkeit für die Verbrechen an Journalist*innen ausgerufen, um so ein Zeichen zu setzen und auf die fortdauernde Untätigkeit vieler Staaten bei der Bekämpfung von Verbrechen an Journalist*innen aufmerksam zu machen. Doch obwohl verschiedene Gremien der Vereinten Nationen in den vergangenen Jahren eine Reihe von Resolutionen zum besseren Schutz von Reporter*innen verabschiedeten, hat sich an deren tatsächlicher Situation kaum etwas zum Besseren geändert.[1]
Doch wie steht es konkret um die Presse- und Informationsfreiheit in den einzelnen Ländern? Weil die Situation für Journalist*innen insgesamt so schlecht ist, war es in den vergangenen fünf Jahren so schwierig wie selten zuvor, einen Vergleich zwischen verschiedenen Staaten zu ziehen. Reporter ohne Grenzen hat daher versucht, mit einer Rangliste der Pressefreiheit einen Maßstab für deren Zustand und Qualität zu erstellen. Die Liste beruht auf der Befragung von Medienexpert*innen und Journalist*innen sowie eigener Korrespondent*innen auf der ganzen Welt. Mit Ausnahme von Laos, Eritrea und Nordkorea wurden und werden in allen 180 Ländern der Rangliste die Fragebögen vor Ort ausgefüllt, um auf diese Weise auch eine Zustandsbeschreibung der Verfolgung und Tötung von Journalist*innen zu erhalten.
Die Zahlen der vergangenen zehn Jahre belegen, dass seit 2011 weltweit insgesamt 843 professionelle und sogenannte Bürgerjournalist*innen wegen ihrer Arbeit getötet wurden.[2] Die meisten Journalist*innen verloren in Afghanistan, Irak, Indien, Mexiko, Pakistan und Syrien ihr Leben – bemerkenswerterweise jedoch im weltweiten Vergleich zumeist außerhalb von Kriegsgebieten, nämlich wenn sie über organisierte Kriminalität, Korruption, Machtmissbrauch oder Menschenrechtsverletzungen berichteten.
Die allermeisten dieser Verbrechen bleiben ungestraft. Inhaftiert wurden dagegen eine Unzahl von Journalist*innen, die meisten in den vergangenen fünf Jahren in Ägypten, China, Myanmar, Saudi-Arabien und der Türkei. Im September 2021 saßen weltweit 455 Journalist*innen hinter Gittern – und das allein wegen ihrer journalistischen Arbeit. Deutlich angestiegen ist dabei die Zahl von inhaftierten Bürgerjournalist*innen, also nicht professionell arbeitenden Medienschaffenden, die dank Facebook, YouTube und Twitter vor allem in autoritären Systemen und Kriegsgebieten die klassische Medienzensur umgehen. Unter den besonders repressiven Staaten finden sich hier unter anderem China, Iran und Vietnam. Ganz entscheidend hängt die globale Lage des Journalismus davon ab, wie sich die Regierungsformen entwickeln und Medienmärkte reguliert werden. Das Beispiel für die jüngste und rapideste Verschlechterung der Pressefreiheit ist zweifellos Afghanistan. In manchen Ländern gab es dagegen auch eine positive Entwicklung durch Demokratisierung zu verzeichnen, etwa in Gambia, das sich auf der Rangliste der Pressefreiheit seit 2016 um mehrere Plätze verbessern konnte, während die Beispiele von Mexiko und der Türkei verdeutlichen, wie sehr sich die Pressefreiheit in zwei sehr unterschiedlichen Ländern in den zurückliegenden Jahren massiv verschlechtert hat.
Dreierlei Exempel: Gambia, Mexiko und die Türkei
In Gambia wurde am 1. Dezember 2016 der bis dahin 22 Jahre lang autoritär regierende Präsident, Yaya Jammeh, abgewählt und von dem in Großbritannien ausgebildeten Unternehmer Adama Barrow abgelöst. Seitdem hat sich Gambia zu einem Land entwickelt, in dem sich Medien freier entfalten können als zuvor: Die staatliche Gewalt gegen Journalist*innen ist zurückgegangen, Zensurgesetze und das Verbot privater Rundfunksender wurden aufgehoben, so dass viele exilierte Journalist*innen wieder ins Land zurückkehrten. Die Regierung hat zudem ein neues Mediengesetz in Aussicht gestellt, will obendrein Haftstrafen für Pressedelikte abschaffen und die Verbrechen der Diktatur aufarbeiten.
Mexiko ist dementgegen zwar eine langjährige Demokratie, zählt aber trotzdem zu den gefährlichsten Ländern für Journalist*innen weltweit: Laut Recherchen von Reporter ohne Grenzen und Propuesta Cívica wurden zwischen 2006 und 2021 mindestens 137 Medienschaffende wegen ihrer Arbeit ermordet oder mit Gewalt verschleppt. Alle Gewalttaten standen im Zusammenhang mit der Arbeit der Opfer, insbesondere wenn sie über Korruptionsfälle berichteten: Mehr als 60 Prozent aller seit 1992 ermordeten Journalist*innen hatten sich mit diesem Thema beschäftigt.
Weit mehr als 90 Prozent der Morde an Medienschaffenden in Mexiko bleiben straflos.[3] Zwar gibt es von staatlicher Seite etliche Programme zum Schutz von Journalist*innen, doch sind diese meist finanziell und personell schlecht ausgestattet. Zusätzlich erschwert wird die Arbeit der Journalist*innen durch prekäre Arbeitsverhältnisse: Mexikos Medien werden weitgehend von einigen der reichsten Unternehmer der Welt kontrolliert, und obwohl die Branche boomt, werden viele Journalist*innen so schlecht bezahlt, dass sie kaum von ihrer Arbeit leben können und umso schutzloser Druck von allen Seiten ausgesetzt sind. Die ungezügelte Medienkonzentration ist auch eine Folge fehlgeschlagener staatlicher Regulierung.[4]
Die Türkei zählte schon lange zu den Ländern, die weltweit am meisten Journalist*innen aufgrund ihrer Arbeit inhaftierten, und bereits vor dem Beginn der Regentschaft von Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan gab es immer wieder Repressionswellen gegen Journalist*innen. Derzeit sitzen mindestens 11 von ihnen in Haft, in den meisten Fällen wegen des Vorwurfs, angeblich Terrorpropaganda verbreitet zu haben. In Dutzenden weiteren Fällen ist ein Zusammenhang der Haft mit der journalistischen Tätigkeit wahrscheinlich. Allerdings kann man dies derzeit nicht nachweisen, da die türkische Justiz die Betroffenen und ihre Anwälte oft für längere Zeit über die genauen Anschuldigungen im Unklaren lässt. Eine enorme Verschärfung der Repressionen erfolgte seit dem Putschversuch im Juli 2016. Seitdem wurden mehr als 160 Medien verboten, und viele Fernsehsender wurden de facto zu sogenannten Pinguin-Sendern gleichgeschaltet, die komplett unpolitisch berichten.[5] Die Beschreibung „Pinguin-Sender“ etablierte sich bereits während der Gezi-Park-Proteste im Jahr 2013, als viele Sender unverdächtige Tierfilme anstelle von Berichten über den Protest gegen Präsident Erdog˘an ausstrahlten. Gleichzeitig versucht dieser immer stärker, die Medien unter seine Kontrolle zu bringen. Neun der zehn meistgesehenen Fernsehsender sowie neun der zehn meistgelesenen überregionalen Tageszeitungen gehören derzeit regierungsfreundlichen Unternehmen.[6]
Die Europäische Union als journalistische Problemregion
Auch in der Europäischen Union gibt die Lage des Journalismus Anlass zur Besorgnis. In keiner anderen Weltregion hat sich die Pressefreiheit in den vergangenen Jahren insgesamt so massiv verschlechtert wie in Europa. Insbesondere in Ost- und Südosteuropa sind Journalist*innen zunehmend medienfeindlicher Hetze durch Regierungen oder führende Politiker*innen ausgesetzt. Das schafft ein feindseliges, vergiftetes Klima, welches den Boden für Gewalt gegen Medienschaffende und staatliche Repression bereitet. Das haben nicht zuletzt die Morde an Ján Kuciak im Februar 2018 und Daphne Caruana Galizia im Oktober 2017 in den EU-Mitgliedsländern Slowakei und Malta gezeigt.
Vor allem in Malta kommt derzeit auch ein neues politisches Kampfmittel der Mächtigen zum Einsatz, mit dem diese kritische Medienschaffende zum Schweigen bringen wollen: die Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPPs). Einflussreiche Geschäftsleute und Politiker*innen versuchen mittels massenhafter rechtsmissbräuchlicher Zivilklagen, Journalist*innen systematisch von ihrer Arbeit abzuhalten oder zu zermürben. Denn diese Klagen werden meist mangels Grundlage abgewiesen, bringen aber für die Gegenseite einen hohen Kosten- und Zeitaufwand mit sich. Allein gegen Daphne Caruana Galizia waren zum Zeitpunkt ihrer Ermordung knapp fünfzig Slapp-Klagen in Malta anhängig.
Repression gegen die neuen Medien
Für eine neue Dimension der Repression sorgten in den vergangenen Jahren darüber hinaus die sozialen Medien, die die Struktur moderner Öffentlichkeit weltweit radikal verändert haben. Einerseits hat das Internet als neuer Kommunikationsraum Presse- und Informationsfreiheit in neuen Formen und Dimensionen ermöglicht. Andererseits bietet es durch ausufernde Massenüberwachung sowie zielgerichtete Beobachtung und Ausspähung auch einen Raum wachsender Repression.
Gehackte Smartphones, angezapfte Telefone, entschlüsselte Festplatten: Digitale Überwachung stellt eine der größten Gefahren für Journalist*innen wie auch ihre Quellen dar. Möglich ist dies, weil der Handel mit Überwachungssoftware bis heute nicht ausreichend kontrolliert wird und völlig undurchsichtig erfolgt. Neben einer nationalen Kontrolle in Deutschland gibt es lediglich eine europäische Regulierung mit zahlreichen Schlupflöchern sowie das Wassenaar-Abkommen, das weltweit aber nur von rund 40 Staaten anerkannt und zudem rechtlich nicht bindend ist. Dass es eine globale Verflechtung zwischen Spähfirmen, demokratischen Regierungen und autokratischen Regimen gibt, zeigten erst vor wenigen Wochen die spektakulären Enthüllungen über die israelische Überwachungssoftware Pegasus.[7]
Neben der zielgerichteten Überwachung höhlt auch die immer intensivere Massenüberwachung den digitalen Quellenschutz aus, der eine der wesentlichen Voraussetzungen für Pressefreiheit darstellt. Für die USA förderte dies vor einigen Jahren bereits Edward Snowden zutage. Dessen ungeachtet ist es dem Bundesnachrichtendienst hierzulande erlaubt, durch Massenüberwachung uneingeschränkt sogenannte Verkehrsdaten von Medienschaffenden und deren Kontakten zu sammeln, auszuwerten und an andere Nachrichtendienste weiterzugeben.[8]
Aus Sicht der Presse- und Meinungsfreiheit dürfte es jedoch nur in einem äußerst engen Rahmen legitime Verwendungszwecke für diese Art von Überwachungstechnologie geben.[9] Eine entsprechend strenge Regulierung müsste sowohl Staaten als auch Unternehmen entschieden in die Pflicht nehmen: Während Regierungen sich untereinander besser über genehmigte Überwachungstechnikexporte austauschen und gemeinsame Standards entwickeln sollten, müssten Unternehmen dazu verpflichtet werden, interne Prozesse einzuführen, mit deren Hilfe sich frühzeitig erkennen lässt, wenn deren Produkte zu Menschenrechtsverletzungen führen.
Bei der Regulierung von Social Media besteht die zentrale politische Herausforderung hingegen darin, die sogenannten Community Standards im Lichte völkerrechtlicher Prinzipien weiterzuentwickeln: Erforderlich ist ein „digitales Hausrecht“ der Konzerne, welches im Einklang mit den nationalen Gesetzen demokratischer Staaten steht – und gleichzeitig die Möglichkeit bietet, nationale Gesetze autoritärer Staaten als illegitime Instrumente der Zensur ablehnen zu können. Die EU-Kommission scheint diesbezüglich immerhin ihren politischen Gestaltungsanspruch entdeckt zu haben, indem sie für den digitalen Raum den sogenannten Digital Services Act (DSA) vorgeschlagen hat.[10] Er sieht vor, die Macht der großen Internetkonzerne, Dienste- und Plattformanbieter sowie Techkonzerne strenger zu regulieren, ohne dabei die Grundsätze des freien Internets aufzuweichen. Sollte der DSA in der vorgelegten Form verabschiedet werden, wäre er zugleich eine zeitgemäße Gegenantwort auf den wachsenden politischen Gestaltungs- und Manipulationsanspruch der Führungen in China und Russland.
Corona und das Misstrauen gegenüber den Medien
Doch nicht nur von „oben“, ausgehend von Regierungen, Geheimdiensten und Behörden, geraten Medien unter Druck, sondern auch von „unten“: Denn seit einigen Jahren – und insbesondere seit Beginn der Coronakrise – wurde der öffentlich artikulierte Zweifel an der Unabhängigkeit der Medien insbesondere in westlichen Demokratien zunehmend lauter.
Langfristig betrachtet hat das Misstrauen zumindest in Westeuropa jedoch nicht signifikant zugenommen: Studien zufolge liegt es – mit gewissen Schwankungen – seit vielen Jahren bei zwanzig bis dreißig Prozent der Bevölkerung. Zugleich ist das Bewusstsein für den Wert von freiem Journalismus in Demokratien weit weniger deutlich ausgeprägt als in autoritären bzw. ehemals autoritär regierten Ländern.[11] Offenbar kann eine größere Meinungsvielfalt auch zu vermehrten Zweifeln an Grundwerten und -rechten wie der Pressefreiheit führen.
Dabei zeigt jedoch gerade die Bekämpfung der Corona-Pandemie, welche Bedeutung die Pressefreiheit gerade in Krisenzeiten besitzt: Eine jüngst erschienene Studie belegt, dass Länder mit einem hohen Maß an Pressefreiheit erfolgreicher bei der Pandemiebekämpfung sind als jene mit weniger Pressefreiheit. Das bestätigt, welche wichtige Rolle Medien beim Erfassen und Verbreiten gesundheitspolitischer Informationen spielen. Indem sie aktuelle Krisenherde und Ausbrüche registrieren, können sie Regierende unter Druck setzen und so dafür sorgen, dass die notwendigen Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung eingeleitet werden.[12]
Vor allem aber zeigt sich bei alledem einmal mehr, dass unabhängige Journalist*innen und Medien schlechthin konstitutiv für Demokratie und Menschenrechte sind. Umso mehr aber kommt es, gerade auch angesichts der zunehmenden Krisenzeiten, darauf an, das Recht auf freien Journalismus entschieden zu verteidigen – und zwar nicht nur in totalitären Regimen, sondern auch in der Demokratie.
[1] Auf UN-Ebene gibt es derzeit eine Initiative für die Einsetzung eines UN-Sonderbeauftragten für den Schutz von Journalist*innen, um das Problem der Straflosigkeit besser anzugehen. Der Deutsche Bundestag hat diese Initiative im Jahr 2017 als weltweit erstes Parlament mit einem fraktionsübergreifenden Beschluss unterstützt.
[2] Vgl. Reporter ohne Grenzen, Jahresbilanz der Pressefreiheit. Getötete Journalistinnen und Journalisten 2020, sowie dies., Barometer der Pressefreiheit 2021, www.reporter-ohne-grenzen.de.
[3] Reporter ohne Grenzen, Journalisten schützen, Straflosigkeit bekämpfen, www.reporter-ohne-grenzen.de, 30.10.2020.
[4] Das belegen die Ergebnisse des Media Ownership Monitor Mexiko, vgl. Reporter ohne Grenzen, Media Ownership Monitor, Mexico, www.mom-rsf.org, 2021.
[5] Reporter ohne Grenzen, Türkei, Unterdrückte Pressefreiheit in Zahlen, www.reporter-ohne-grenzen.de, 29.1.2021.
[6] Reporter ohne Grenzen, Media Ownership Monitor, Turkey, www.mom-rsf.org, 2021.
[7] Vgl. Reporter ohne Grenzen, Pegasus-Affäre, Aufklärung gefordert, www.reporter-ohne-grenzen.de, 8.9.2021, sowie Daniel Leisegang, Pegasus oder: Der Angriff auf die Schwachstellen, in: „Blätter“, 9/2021, S. 17-21. – D. Red.
[8] Vgl. Reporter ohne Grenzen, BND-Gesetz, Verpasste Chance für die Pressefreiheit, www.reporter-ohne-grenzen.de, 26.3.2021. Dagegen ist derzeit ein von Reporter ohne Grenzen angestrengtes Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anhängig, vgl. Reporter ohne Grenzen, Massenüberwachung, Etappensieg für Beschwerde gegen BND, www.reporter-ohne-grenzen.de, 11.1.2021.
[9] „Wirklich sicher sind nur Zettel und Stift“, so der Autor im Gespräch mit der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, www.faz.net, 14.8.2021.
[10] Europäische Kommission, Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über einen Binnenmarkt für digitale Dienste (Gesetz über digitale Dienste) und zur Änderung der Richtlinie 2000/31/EG, www.eur-lex.europa.eu, 15.12.2020; Reporter ohne Grenzen, Empfehlungen zum Gesetz über Digitale Dienste (DSA) und zum Gesetz über Digitale Märkte (DMA), www.reporter-ohne-grenzen.de, 2021. Vgl. dazu auch: Dominik Piétron und Philipp Staab, EU gegen Big Tech: Das Ende der Gesetzlosigkeit?, in: „Blätter“, 2/2021, S. 95-101. – D. Red.
[11] Vgl. World Values Survey, www.worldvaluessurvey.org, 2021. Bezogen auf Deutschland spiegelt sich das auch in der Mainzer Langzeitstudie Medienvertrauen wider, www.medienvertrauen.uni-mainz.de, April 2021.
[12] Vgl. Gaurav Chiplunkar und Sabyasachi Das, Political institutions and policy responses during a crisis, in: „Journal of Economic Behavior & Organization“, Mai 2021, S. 647-670.