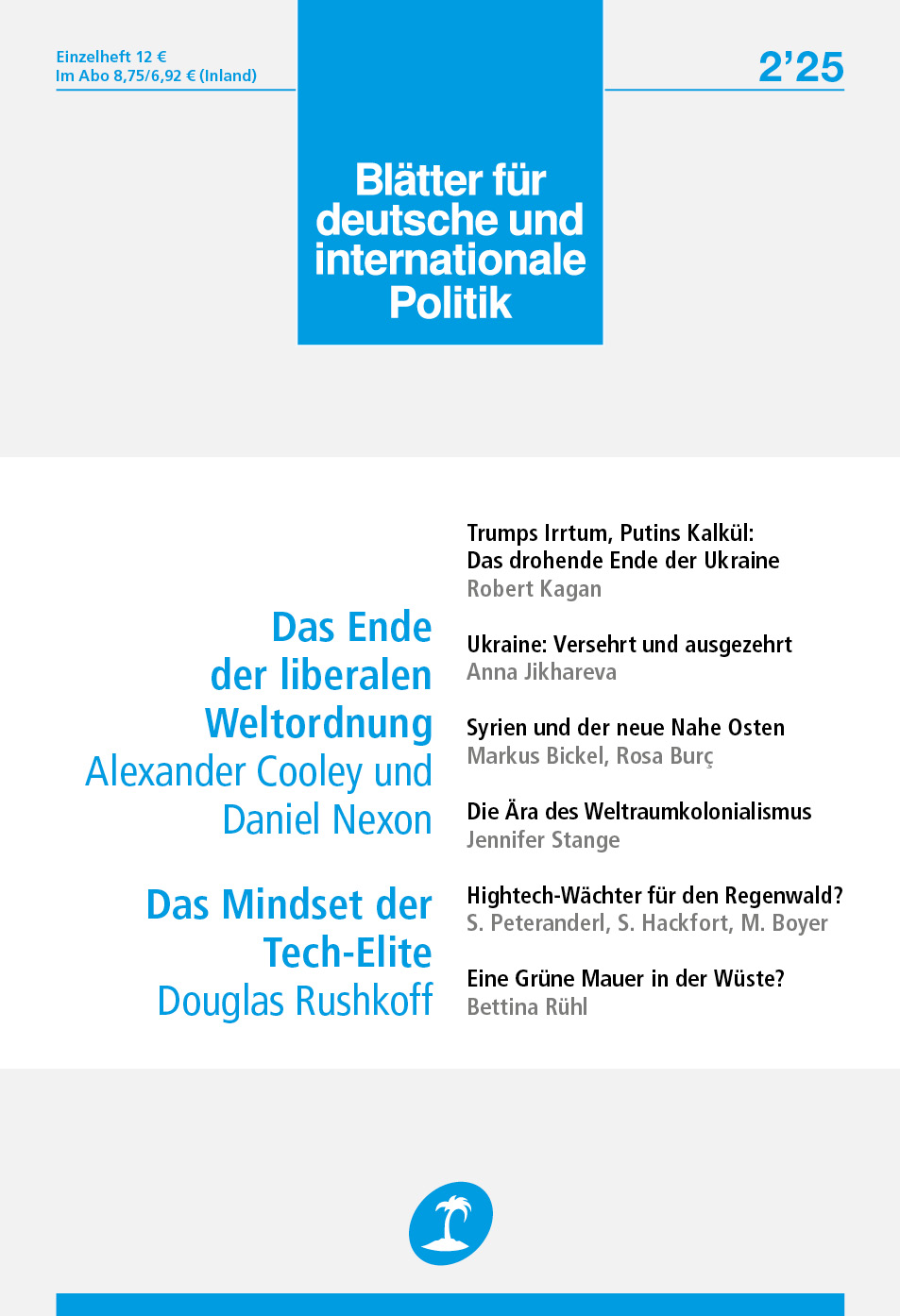Zum Tode von Ingeborg Maus
Wer mit Ingeborg Maus sprechen wollte, wurde von ihr meist auf den Abend verwiesen: Bevorzugt nach 20 Uhr ließ sich die Professorin für „Politologie mit dem Schwerpunkt politische Theorie und Ideengeschichte“ an der Frankfurter Goethe-Universität anrufen und klärte dann geduldig und stets zugewandt organisatorische und akademische Fragen, oftmals bis weit in die Nacht. Natürlich musste man erst einmal durchkommen, denn es waren viele, die etwas mit ihr besprechen wollten. Gelang es aber, erlebte man in der Mischung aus telefonischer Nähe und örtlicher Ferne eine hoch konzentrierte Wissenschaftlerin in voller Intensität. Aus Fragen um Details einer Formulierung wurde so leicht eine Abhandlung über die Geschichte der Demokratie und ihrer Theorie.
Für Ingeborg Maus war der Gang der Demokratie keine Fortschrittsgeschichte, sondern die andauernde Entfremdung der Demokratie von sich selbst, der sie praktisch und theoretisch entgegenzuwirken versuchte. Im Geist der Kritischen Theorie analysierte sie, wie politische Exekutiven und Justiz sich sukzessive verselbstständigen und gesetzgebende Körperschaften entmachten. Anders als heutige Diagnosen es nahelegen, sah sie diesen Prozess der Schwächung demokratischer Souveränität auch in den existierenden liberalen Demokratien am Werke. Anstelle der Demokratisierung der Gesellschaft drohe die Refeudalisierung sozialer und politischer Verhältnisse im Sinne des frühen Habermas.
Als junge Mitarbeiterin der Politikwissenschaft in Frankfurt am Main demonstrierte sie in den späten 1960er Jahren mit lückenlosem Scharfsinn, wie Carl Schmitts Theorie das Rechtsdenken in der Bundesrepublik bis weit in die „bürgerliche Rechtstheorie“ – und auch in die ausgeübte Praxis der (Verfassungs-)Rechtsprechung hinein – prägte.[1] Ihre Studien zur Verschränkung von Recht und Demokratie in der Moderne setzte Ingeborg Maus mit ihren Schriften über „Rechtstheorie und Politische Theorie im Industriekapitalismus“ fort.[2] Vor dem Hintergrund dieser Analysen wurde die Wiederbelebung der demokratischen Tradition der Aufklärung ihr oberstes Anliegen. Dabei wich sie von der Adorno-Horkheimerschen Diagnose einer Dialektik der Aufklärung insofern ab, als sie gerade in einem Rückgriff auf die Aufklärung den Schlüssel für die Korrektur der Gegenwart sah. Maus beschrieb die spezifische Malaise demokratischen Denkens in Deutschland als ein anhaltendes Unverständnis gegenüber den radikaldemokratischen Vorstellungen Kants und Rousseaus. Damit widersprach sie konsequent der Engführung des politischen Denkens auf einen Kalte-Krieg-Liberalismus, der die Französische Revolution und die ihr zugeordneten verfassungstheoretischen Traditionen im Zeichen des Antitotalitarismus als antidemokratisch verdammte.[3]
Gegen eine typisch obrigkeitsstaatliche Lesart, die Demokratie allein in Bürgerrechten verwirklicht sieht, und zugleich in Opposition zu einer Bewegungslinken, die allein auf spontane Demokratie von unten setzt, entwarf Maus Demokratie als Zusammenwirken institutionalisierter und nichtinstitutionalisierter Partizipationsformen. Ihre diagnostische Rekonstruktion gipfelte 1992 in ihrem Grundlagenwerk mit dem treffenden Titel „Zur Aufklärung der Demokratietheorie“.
Nach ihrer Mitarbeit in der von Jürgen Habermas geleiteten „Arbeitsgruppe Rechtstheorie“ wirkte Ingeborg Maus von 1992 bis 2003 als Professorin für Politische Theorie und Ideengeschichte. Ebenfalls in den frühen 1990er Jahren wurde sie Mitherausgeberin dieser Zeitschrift. Von ihren programmatischen Aufsätzen in den „Blättern“ ist angesichts der aktuellen Lage der wohl wichtigste „‚Volk‘ und ‚Nation‘ im Denken der Aufklärung“.[4] Darin legte Maus bereits 1994 grundlegend dar, dass in der Aufklärung das „Volk“ die Nicht-Funktionäre der gesellschaftlichen Basis meint und die „Nation“ schlicht die Gemeinschaft derjenigen ist, die sich dem gemeinsam gegebenen Gesetz unterstellen. Diese Klarstellung ist gerade heute richtungsweisend für die Auseinandersetzung mit einem essentialistischen Volks- und Nationsbegriff, wie er vom Populismus ins Feld geführt wird.
Ihre Ehrung Helmut Ridders, des langjährigen Mitherausgebers der „Blätter“, zu dessen 85. Geburtstag im Jahr 2004 geriet zu einer grundsätzlichen Abrechnung mit „juridischer Demokratieverhinderung“.[5] Hier zeigte sie, wie die kritischen Verfassungsanalysen Ridders, der mit einem Gutachten auch erst die Veröffentlichung ihrer Dissertation ermöglicht, wenn nicht gar erzwungen hatte, sich weiter entwickeln ließen.
Ein Kommentar zum Entwurf der EU-Verfassung wuchs sich zu einer dreiteiligen Reihe in den „Blättern“ (Ausgaben 6 bis 8/2005) zur „Verteidigung der Verfassungsprinzipien des ‚alten‘ Europa“ aus. In einem weiten Rückgriff auf die Rechts- und Demokratietheorien der Aufklärung entwickelte sie darin den formalen Zusammenhang von gesetzgeberischer Suprematie und Gewaltenteilung und brandmarkte den EU-Entwurf als Aufhebung dieses Zusammenhangs.
Auch im Völkerrecht kritisierte sie mit Nachdruck die rechtsaufhebenden Tendenzen. Konsequent widersprach sie überpositiven Begründungen für humanitäre Interventionen. Die einmal entfesselten militärischen Dynamiken erschienen ihr unbeherrschbar, die freigesetzten moralaffinen Prozesse als eine grundsätzliche Gefährdung des Rechts. Auch nach einem Angriffskrieg darf es keinen „ungerechten Feind“ geben, der als außerhalb des Rechts stehend begriffen wird. Dass gegen den Nationalsozialismus nur die militärische Intervention erfolgversprechend war, brachte sie nicht von einer Friedenspolitik ab, die die Eskalation fürchtet und das Recht hütet.
Der Schärfe ihrer Argumente steht die Bescheidenheit bei der Präsentation ihrer eigenen Leistung gegenüber: 2011 versammelte sie ihre Maßstäbe setzenden Schriften zur Volkssouveränität unter dem zurückhaltenden Titel „Elemente einer Demokratietheorie“. Diese wie die ebenfalls bei Suhrkamp gesammelten Aufsätze zur Internationalen Politik (2015) und zur Rechtstheorie (2018) wirken stilbildend für die Demokratietheorie des 20. Jahrhunderts.
Mit dem Tod von Ingeborg Maus am 14. Dezember 2024 verließ uns eine Politische Theoretikerin und im besten Sinne meinungsbildende Professorin, die mit unerschütterlicher Reflexionsgabe zu einer der großen Leitfiguren aufklärerischen Denkens der Bundesrepublik avancierte.
[1] Ingeborg Maus, Bürgerliche Rechtstheorie und Faschismus. Zur sozialen Funktion und aktuellen Wirkung der Theorie Carl Schmitts, 2. erw. Aufl., München 1980.
[2] München 1986.
[3] Vgl. Samuel Moyn, Der Liberalismus gegen sich selbst. Intellektuelle im Kalten Krieg und die Entstehung der Gegenwart, Berlin 2024.
[4] „Blätter“, 5/1994, S. 602-612.
[5] „Blätter“, 7/2004, S. 835-850.