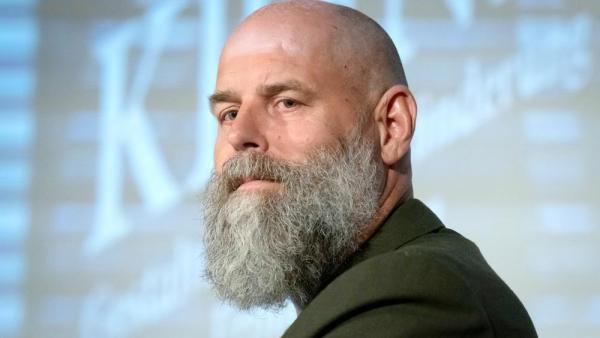Die Hemmschwelle für antisemitischen Mord ist gefallen. Am 13. November 1992 gerieten zwei Nazis in einer Wuppertaler Gaststätte in Streit mit einem 53jährigen Mann. Die verbale Auseinandersetzung eskalierte, als die Männer in ihrem Gegenüber einen Juden zu erkennen glaubten. Sie zertrampelten ihn, zündeten ihn an und schafften die Leiche über die Grenze nach Venlo. Der Mord wurde hierzulande erst bekannt, nachdem das israelische Fernsehen darüber berichtet hatte. Und während die internationale Öffentlichkeit entsetzt war - stellvertretend sei die Schlußfolgerung der "Unita" zitiert: "Das ist die Straße nach Auschwitz" -, ließ die deutsche Staatsanwaltschaft die erste Zeugenaussage schnell dementieren und behauptete, bei dem Verbrechen habe Antisemitismus "überhaupt keine Rolle gespielt". Die Wuppertaler Bluttat und die im folgenden bekanntgewordenen Morddrohungen gegen den Schriftsteller Ralph Giordano sind allerdings nur der vorläufige Höhepunkt einer Entwicklung, die präzise mit dem November 1989 begonnen hat. Im Prozeß der Wiedervereinigung ist der vorher latente Antisemitismus virulent geworden. Die Monate nach der Maueröffnung waren von einer Welle von Verwüstungen jüdischer Friedhöfe begleitet, wie sie seit drei Jahrzehnten nicht mehr vorgekommen war.
In der Januar-Ausgabe skizziert der Journalist David Brooks, wie die so dringend nötige Massenbewegung gegen den Trumpismus entstehen könnte. Der Politikwissenschaftler Philipp Lepenies erörtert, ob die Demokratie in den USA in ihrem 250. Jubiläumsjahr noch gesichert ist – und wie sie in Deutschland geschützt werden kann. Der Politikwissenschaftler Sven Altenburger beleuchtet die aktuelle Debatte um die Wehrpflicht – und deren bürgerlich-demokratische Grundlagen. Der Sinologe Lucas Brang analysiert Pekings neue Friedensdiplomatie und erörtert, welche Antwort Europa darauf finden sollte. Die Journalistinnen Susanne Götze und Annika Joeres erläutern, warum die Abhängigkeit von Öl und Gas Europas Sicherheit gefährdet und wie wir ihr entkommen. Der Medienwissenschaftler Roberto Simanowski erklärt, wie wir im Umgang mit Künstlicher Intelligenz unsere Fähigkeit zum kritischen Denken bewahren können. Und die Soziologin Judith Kohlenberger plädiert für eine »Politik der Empathie« – als ein Schlüssel zur Bekämpfung autoritärer, illiberaler Tendenzen in unserer Gesellschaft.