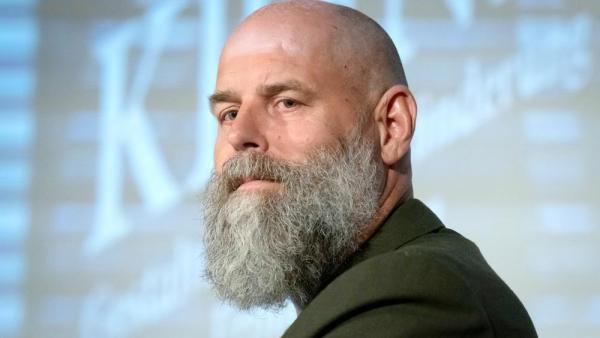Das Fernsehen hat uns angeblich aufgeklärt. Weil wir von überallher Bilder zusammenraffen, sollen wir der Wahrheit näher sein und das soll uns dabei helfen, andere Völker zu befreien. Jetzt explodieren also wieder einmal Bomben am anderen Ende der Welt, füllen die Videobänder des Pentagon die Mattscheibe, werden die Ziele der Bomben in Zeitlupe und mit Sofortwiederholung bei der Explosion verfolgt; die gequälten Gesichter von Flüchtlingen sind mit Staub bedeckt und tränenüberströmt, der Feind verkündet den Bombardierungen zum Trotz seinen Widerstand, das Fernsehen überschüttet uns ständig mit weiteren Beweisen der Barbarei, die erbitterten Gesichter der Geiseln starren uns an, und wir sind ebensowenig aufgeklärt, klarsichtig, hilfreich wie zuvor. Das beständigste Medienklischee leitet sich von Marshall McLuhan her, der vor mehr als dreißig Jahren schrieb, daß Fernsehen zwangsläufig die Welt vereinen müsse. Dank der Geschwindigkeit, mit der sich die Bilder bewegten, würden wir "mythisch und ganzheitlich leben", befreit von Grenzen und Provinzialismus, denn, so McLuhan, "Elektrische Schaltungen haben die Diktatur von 'Raum' und 'Zeit' gestürzt und übergießen uns unablässig mit den Angelegenheiten aller anderen Menschen...
In der Februar-Ausgabe analysiert Ferdinand Muggenthaler die Folgen des US-Militärschlags in Venezuela für Lateinamerika – und erläutert, an welche Grenzen Trumps imperiale Ambitionen auf dem Subkontinent stoßen könnten. Nach vier Jahren russischer Vollinvasion und einem Jahr Trump ist die Ukraine zu einem zentralen Schauplatz im Ringen um eine imperiale globale Ordnung avanciert, argumentiert Steffen Vogel. Ulrich Menzel beschreibt die Konturen des heranbrechenden neuen imperialistischen Zeitalters, in dem das »Trio infernale« – USA, Russland und China – miteinander um die globale Vorherrschaft ringt. Seyla Benhabib beleuchtet unter Rückgriff auf das Denken Hannah Arendts die dramatischen Herausforderungen der Demokratie im planetarischen Zeitalter. Sonja Peteranderl zeigt auf, wie sich deutsche Behörden aus ihrer Abhängigkeit von Trump-hörigen Tech-Konzernen lösen können. Dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk hierzulande nicht nur innenpolitisch unter Druck steht, sondern auch ausländische Regierungen politisch Einfluss auszuüben versuchen, zeigt Wolfgang Kraushaar am Beispiel der Kontroverse um die ARD-Israel-Korrespondentin Sophie von der Tann. Und Georg Diez plädiert angesichts der wachsenden Stimmenanteile der AfD für die Abkehr von Parteidisziplin und den Umbau der Demokratie hin zu einer zielorientierten Zwei-Drittel-Republik.