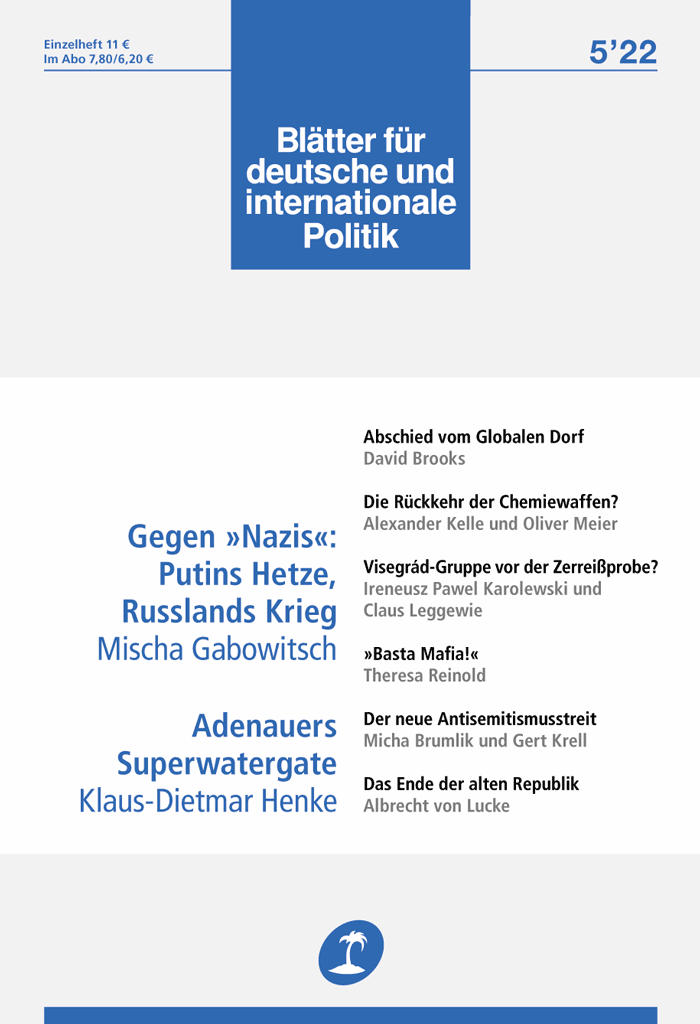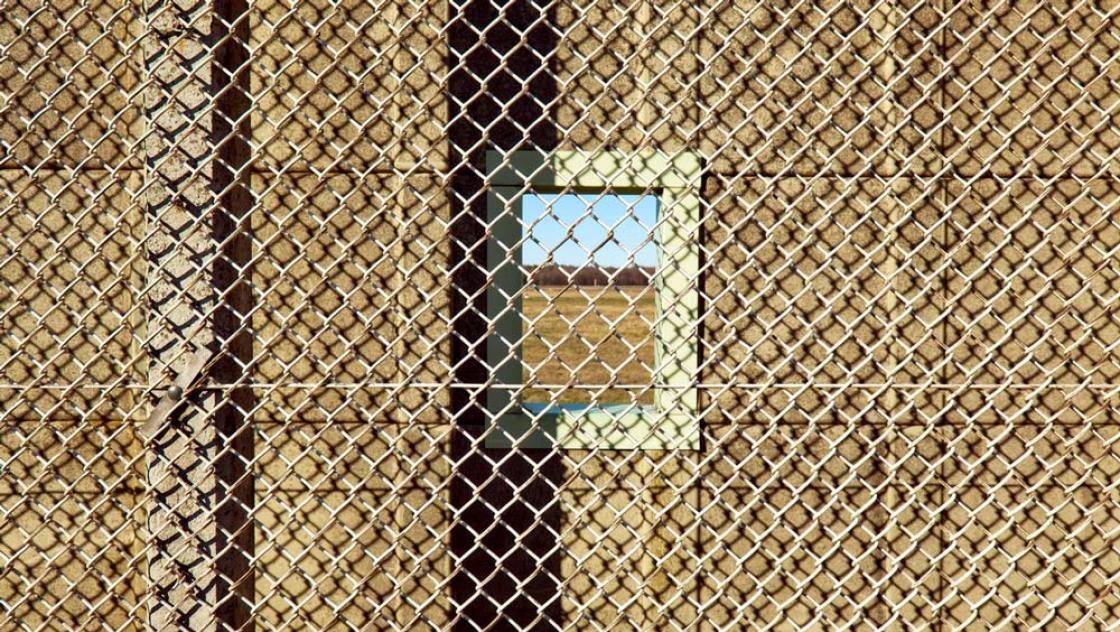
Bild: zettberlin / photocase.de
Ich gehöre einer vom Glück begünstigten Generation an. Ich kann mich an eine Zeit erinnern – es ist ungefähr 25 Jahre her –, als die Welt scheinbar zusammenrückte. Der große Wettstreit des Kalten Krieges zwischen Kommunismus und Kapitalismus schien ein Ende gefunden zu haben. Die Demokratie breitete sich immer noch aus. Die ökonomischen Verknüpfungen zwischen den Ländern nahmen zu. Das Internet schien die weltweite Kommunikation zu fördern. Es sah so aus, als würde sich die Welt einer Übereinkunft über eine Reihe universeller Werte nähern – Freiheit, Gleichheit, Menschenwürde, Pluralismus, Menschenrechte.
Diesen Prozess der Annäherung nannten wir Globalisierung. In erster Linie ging es dabei um wirtschaftliche und technologische Prozesse – wachsende Handelsströme und Investitionen zwischen den Ländern und die Verbreitung von Technologien, die uns zum Beispiel Wikipedia brachten. Aber Globalisierung war immer auch ein politischer, sozialer und ethischer Prozess.
In der 1990er Jahren argumentierte der britische Soziologe Anthony Giddens, dass Globalisierung „ein Wandel unserer Lebensumstände ist; die Art, wie wir heute leben.“ Dies schloss die „Intensivierung von sozialen Beziehungen weltweit“ ein. Globalisierung betraf die Integration von Weltanschauungen, Produkten, Ideen und Kulturen.
Dies passte zu einer akademischen Theorie, die damals im Umlauf war, die Modernisierungstheorie.