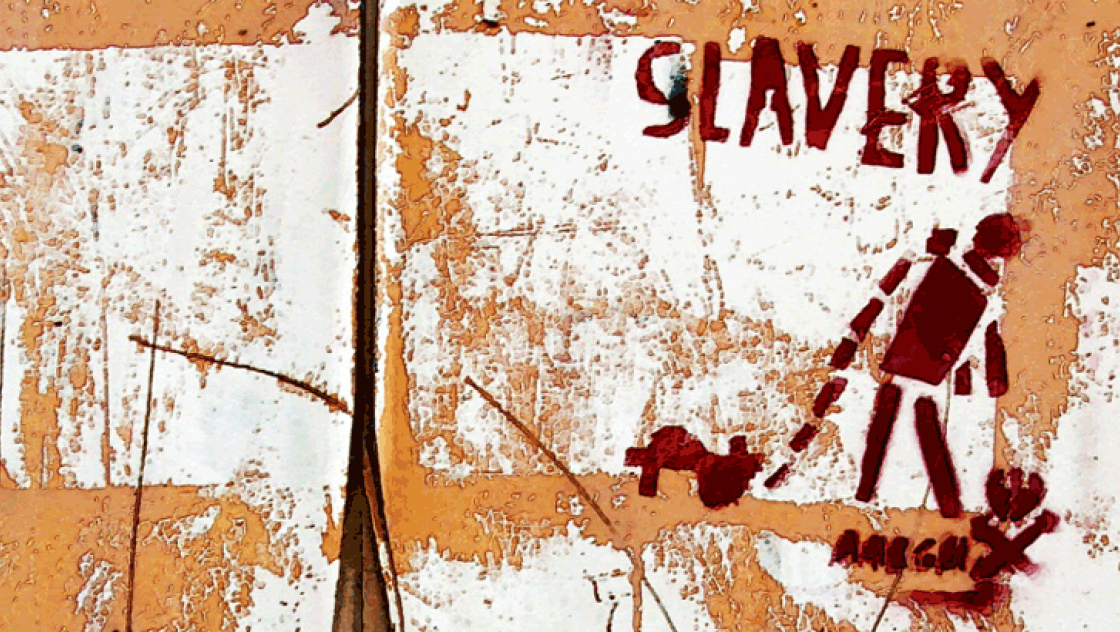Ob Kinderarbeit auf Kakaoplantagen oder Näherinnen in Bangladesch – stehen unmenschliche Arbeitsbedingungen im Fokus, fällt rasch das Wort »Sklaverei«. Die Analyse der jeweiligen Kontexte kommt dabei allerdings meist zu kurz, kritisiert die Sozialwissenschaftlerin Janne Mende.
Immer wieder taucht heutzutage in den Medien ein Begriff auf, der noch am Ende des 20. Jahrhunderts als Gegenstand der Vergangenheit galt: Sklaverei. Heute werden entsprechende Praktiken in Abgrenzung von ihren historischen Formen und vom transatlantischen Sklavenhandel als „moderne Sklaverei“ bezeichnet.
Doch was genau unter dem Begriff zu verstehen ist, darüber gibt es keine Einigkeit – eine einheitliche Definition sucht man vergebens. Stattdessen gibt es eine Vielzahl von Fallbeispielen und Berichten über moderne Sklaverei, internationale, regionale und staatliche Abkommen, die das Phänomen in je unterschiedlicher Weise definieren, sowie Studien und sozialwissenschaftliche Debattenbeiträge, die sich kritisch mit der modernen Sklaverei auseinandersetzen. Zusammen ergeben all diese Beiträge ein heterogenes Bild dessen, was heute unter moderner Sklaverei verstanden wird.
Aus diesem Grund schwanken auch die Schätzungen darüber, wie viele Menschen weltweit in Sklaverei leben. Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) etwa geht von 21 Millionen Sklavinnen und Sklaven aus, die Walk Free Foundation von rund 46 Millionen. Aktuelle Fälle, die als Beispiele moderner Sklaverei gelten, sind Arbeiter im Fischfang in Indonesien und in Thailand sowie Arbeiterinnen in der Bekleidungsindustrie in Bangladesch, deren Produkte über Handelsketten nach Europa und Amerika gelangen, migrantische Hausangestellte in England, Dienstmädchen und Bauarbeiter in Katar und das stets kontrovers diskutierte Feld der Sexarbeit.
Erforderlich ist in jedem Fall eine Differenzierung. Denn die Formen der Ausbeutung unterscheiden sich grundlegend: Sie reichen von Schuldknechtschaft und Vertragssklaverei über entrechtlichte Hausarbeit bis hin zu Besitzsklaverei, Zwangsarbeit, Menschenhandel und Kinderarbeit.
So werden in der Schuldknechtschaft und Vertragssklaverei die Arbeiterinnen und Arbeiter durch Verschuldung – etwa über unbezahlbare Kredite und Vorschüsse – an den Arbeitsplatz gefesselt. Dies betrifft oft saisonale Arbeiten. Mitunter bekommen die Arbeiter am Ende der Saison ihre Schuld erlassen und können in ihren Heimatort zurückkehren, bis sie von Rekruten und Mittelsmännern für die nächste Saison verpflichtet werden bzw. sich für eine Verpflichtung entscheiden. Der Eintritt in die Vertragssklaverei kann also durchaus aufgrund einer freiwilligen Entscheidung erfolgen. Die Arbeitsbedingungen und das Ende der Vertragsbeziehung entziehen sich jedoch einer Mitsprachemöglichkeit.
Moderne Schuldknechtschaft findet sich vor allem in Ziegelhütten und in der Landwirtschaft Indiens und Pakistans, wo sie an lokale, weit zurückreichende Traditionen anschließt. Vertragssklaverei kommt aber auch in reichen Ölstaaten vor – insbesondere in den Bereichen Bau, Haushalt und Sexarbeit. Daneben ist Brasilien ein bekanntes Beispiel für moderne Vertragssklaverei – hier werden Arbeiterinnen und Arbeiter insbesondere in der Holzwirtschaft ausgebeutet. Sie werden mit Versprechungen angelockt und dann unter Anwendung von Gewalt in isolierten Arbeitslagern festgehalten. Auch hier spielt eine kaum reduzierbare Verschuldung für ihren Transport und ihre Unterbringung eine entscheidende Rolle. Die brasilianische Regierung, die Programme gegen diese Form der Sklaverei initiiert hat, benennt unter anderem die multinationalen Konzerne Walmart und Carrefour als über Produktionsketten beteiligte Unternehmen. Das zeigt: Von der Vertragssklaverei profitieren nicht nur lokale Produzenten, sondern auch globale Produktionsnetzwerke, transnationale Unternehmen und damit indirekt auch europäische Konsumentinnen und Konsumenten.
Eine weitere Form moderner Sklaverei sind entrechtlichte, gewaltsame Arbeitsbedingungen in der Hausarbeit. Sie betreffen fast immer Frauen, zumeist Migrantinnen, finden sich in nahezu allen Ländern der Welt – in Mittel- und Oberschichthaushalten des globalen Nordens und des globalen Südens, in sogenannten Expat-Haushalten[1] ebenso wie in lokal ansässigen Familien. Hausarbeit findet in der Regel in privaten Räumen statt und geht bei Migrantinnen oft mit einem illegalen, unsicheren oder unmittelbar an den Arbeitsplatz geknüpften Aufenthaltsstatus einher. Sie sind besonders durch Missbrauch, Ausbeutung, Lohnentzug, körperliche und sexuelle Gewalt gefährdet. Verbreitet ist das Phänomen beispielsweise in Großbritannien, wo die Betroffenen zwar meist legal einreisen, dann aber mit Gewalt oder Passentzug von ihren Arbeitgebern unter Druck gesetzt werden.
»Obwohl die Besitzsklaverei mit Zwang und Gewalt verbunden ist, werden nicht alle Betroffenen gegen ihren Willen festgehalten.«
Schließlich gibt es die Besitzsklaverei, die dem vormodernen Verständnis von Sklaverei am ehesten entspricht. Sie ist vor allem in Mauretanien, im Sudan, in Mali und im Niger verbreitet. Betroffene werden in die Sklaverei geboren, entführt oder verkauft. Häufig gehören sie Ethnien, Schichten oder Kasten an, die in der jeweiligen Gesellschaft am unteren Ende der sozialen Hierarchien stehen. Sie werden meist in der häuslichen, vieh- und landwirtschaftlichen Arbeit eingesetzt und sehen sich mit lebenslanger Ausbeutung und Gewalt sowie teilweise mit Zwangskonvertierungen zum Islam konfrontiert. Obwohl diese Form der Sklaverei mit einem hohen Maß an Zwang und Gewalt verbunden ist, ist auch hier nicht in allen Fällen sicher, dass die Betroffenen gegen ihren Willen festgehalten werden. Denn es besteht durchaus die Möglichkeit, dass Betroffene am Ende freiwillig bei ihren Kidnappern, Käufern oder Beschützern bleiben, etwa um der Unsicherheit und dem Hunger in ihren Herkunftsregionen zu entkommen.
Wie schwierig es ist, moderne Sklaverei und ihre verschiedenen Formen zu definieren, zeigt sich auch daran, dass die Begriffe „Zwangsarbeit“ und „Menschenhandel“ oft synonym zum Begriff der modernen Sklaverei verwendet werden.
Zwangsarbeit bezeichnet Arbeit, die gegen den Willen der Betroffenen, unter Anwendung oder Androhung von Gewalt erzwungen wird. Laut ILO zählen auch Schuldknechtschaft, die Androhung von Auslieferung an Immigrationsbehörden oder der Entzug von Ausweisdokumenten zur Zwangsarbeit, so dass die definitorischen Grenzen zu moderner Sklaverei fließend sind. Zwangsarbeiter werden von Privatpersonen, vom Staat, vom Militär und von Unternehmen eingesetzt, vor allem in der Hausarbeit, in der Landwirtschaft, im Bau, in Fabriken und im Sexarbeitssektor.
Von Menschenhandel – laut United States Trafficking Victims Protection Act aus dem Jahr 2000 die am weitesten verbreitete Erscheinungsform moderner Sklaverei – ist die Rede, wenn Menschen gegen ihren Willen, unter Ausübung oder Androhung von Gewalt oder unter falschen Versprechen zum Zwecke der Ausbeutung an einen anderen Ort verbracht werden. Das Überschreiten von Grenzen ist gemäß Anti-Slavery International kein erforderliches Kriterium für die Definition von Menschenhandel. Die Übergänge zwischen Menschenhandel und dem Schleusen von Menschen können fließend sein, wenn Abschnitte des Migrationsprozesses unter Zwang stattfinden oder wenn eine freiwillig angetretene Migration in einem Zwangsarbeitsverhältnis mündet.
Auch die Klassifizierung von Kinderarbeit als Sklaverei ist mehr noch als andere Formen der Sklaverei umstritten. Besonders umstritten ist die Unterscheidung zwischen selbst- und fremdbestimmter Kinderarbeit, zwischen legitimen und illegitimen, ausbeuterischen und weniger ausbeuterischen Formen von Kinderarbeit mit jeweils fließenden und umkämpften Grenzziehungen sowie die Frage der ökonomischen Notwendigkeit von Kinderarbeit.
Die UN-Kinderrechtskonvention von 1989 etwa spricht von wirtschaftlicher Ausbeutung, wenn die Erziehung, die Gesundheit oder die Entwicklung des Kindes gefährdet sein können (Art. 32.1). Das ILO-Programm zur Beseitigung von Kinderarbeit zählt zu deren schlimmsten Formen sklavereiähnliche, gesundheitsgefährdende und illegale Arbeiten, Kinderhandel, zwangsrekrutierte Kindersoldaten und Prostitution.[2] Begleitet werden die Auseinandersetzungen um Bestimmungen und Grenzen der Kinderarbeit von der Frage der Definition von Kindheit. Während im Völkerrecht Personen unter 18 Jahren als Kinder gelten, wird nicht nur die Altersgrenze, sondern auch der Anspruch auf eine geschützte Kindheit teilweise als westliches Konstrukt zurückgewiesen.[3]
Der kleinste gemeinsame Nenner all dieser Definitionen von moderner Sklaverei und Menschenhandel sind die Kriterien der fehlenden Einwilligung, der Anwendung oder Androhung von Gewalt und einer – in der Regel ökonomischen – Ausbeutung. Doch diese scheinbare definitorische Eindeutigkeit ist trügerisch. Ob ein extrem ausbeuterisches Arbeitsverhältnis freiwillig eingegangen wurde oder nicht, ist oft schwer zu bestimmen. Für den politischen und rechtlichen Umgang mit Sklaverei ist diese Unterscheidung jedoch zentral: Wurden die Betroffenen manipuliert und mit falschen Versprechungen gelockt und müssen befreit werden? Oder haben sie sich bewusst in unsichere, gewaltvolle Situationen begeben, womöglich aufgrund familiärer oder ökonomischer Zwänge?
Letztere können durch klassische Maßnahmen zur Bekämpfung von Sklaverei wie Polizeieinsätze, Verbote und Razzien keineswegs verbessert werden – im Gegenteil: Anti-Sklaverei-Politik kann die Lebensumstände von Betroffenen sogar verschlimmern. Denn durch sie werden Betroffene oft noch weiter marginalisiert und entweder als illegale Migrantinnen und Migranten oder als sozial Ausgestoßene, die gesellschaftlich nicht anerkannten Tätigkeiten nachgehen, stigmatisiert.
»Bei der ›apolitischen Wohlfühl-Woodstock-Mobilisierung gegen moderne Sklaverei‹ bleiben ökonomische, strukturelle und staatliche Gewalt außen vor.«
Besonders deutlich zeigt sich die Ambivalenz der gegenwärtigen Anti-Sklaverei-Politik an der aktuellen Flüchtlingsdebatte. Die Begriffe der modernen Sklaverei und des Menschenhandels werden hier in eins gesetzt, und der Begriff des Menschenhandels wird zunehmend für alle Formen des illegalen Transports von Flüchtlingen über Grenzen hinweg verwendet. Völkerrechtlich unterscheidet sich jedoch laut Palermo-Konvention – das UN-Übereinkommen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität aus dem Jahr 2000 – der mit Zwangselementen und zum Zwecke der Ausbeutung durchgeführte Menschenhandel vom Schleusen, für das Migranten und Migrantinnen bezahlen, um – freiwillig – über Grenzen gebracht zu werden. Trotz dieser konzeptionellen Unterscheidung wird das Schleusen von Menschen hier – wie auch im öffentlichen Diskurs – in denselben Kontext der organisierten Kriminalität gestellt wie Menschenhandel und moderne Sklaverei und damit indirekt eine entsprechende Bekämpfung legitimiert.
Gleichzeitig geraten die Umstände für die Entscheidung zur Migration aus dem Blick, wenn der Fokus auf die kriminelle Handlung des Schleusens oder auch des Menschenhandels gelegt wird. Oft liegen weder die möglicherweise zwingenden Gründe für die Entscheidung noch die genauen Umstände des Grenzübertritts in den Händen der Betroffenen.
Diese Problematik werfen Kritiker dem Konzept moderner Sklaverei insgesamt vor. Denn im Rahmen der „apolitischen Wohlfühl-Woodstock-Mobilisierung gegen moderne Sklaverei“[4] blieben ökonomische, strukturelle und staatliche Gewalt stets außen vor. Dies gelte umso mehr, als sich die aktuelle Anti-Sklaverei-Politik hervorragend mit neoliberaler Wirtschafts- und repressiver Migrationspolitik verbinden lässt. Die Ursachen von Migration und ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen wie beispielsweise die Abwesenheit von Staatlichkeit oder extreme gesellschaftliche Ungleichheit und Diskriminierung würden von dem Begriff der modernen Sklaverei und den daraus abgeleiteten politischen Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung grundsätzlich nicht erfasst, so die Kritik.
Ob im Rahmen oder jenseits des Konzeptes moderner Sklaverei: Entscheidend ist es, Praktiken und Prozesse der Sklaverei, der Ausbeutung, der Migration, der Flucht, der Sexarbeit und der Ungleichheit im Rahmen ihrer jeweils spezifischen ökonomischen, sozialen und politischen Kontexte zu analysieren. Nur dann können Formen struktureller Gewalt, Achsen der sozialen, politischen und ökonomischen Ungleichheit, insbesondere Geschlecht, Klasse, Kaste, Ethnizität, Familienstatus, Alter oder Staatsangehörigkeit offengelegt werden. Und nur dann kann es gelingen, eine emanzipatorische Politik zu entwickeln, um den zahlreichen Formen der Ausbeutung und der Ungleichheit nachhaltig zu begegnen.
[1] Expatriate, kurz Expat, wird eine Fachkraft genannt, die von einem international tätigen Unternehmen vorübergehend an eine ausländische Zweigstelle entsandt wird.
[2] Vgl. Art. 3 der ILO-Konvention Nr. 182 zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit.
[3] Vgl. Benjamin N. Lawrance, From child labor „problem“ to human trafficking „crisis“. Child advocacy and anti-trafficking legislation in Ghana, in: „International Labor and Working-Class History“, 1/2010, S. 63-88.
[4] Julia O’Connell Davidson, The making of modern slavery. Whose interests are served by the new abolitionism?, in: „British Academy Review”, 24/2014, S. 28-31, hier S. 31.