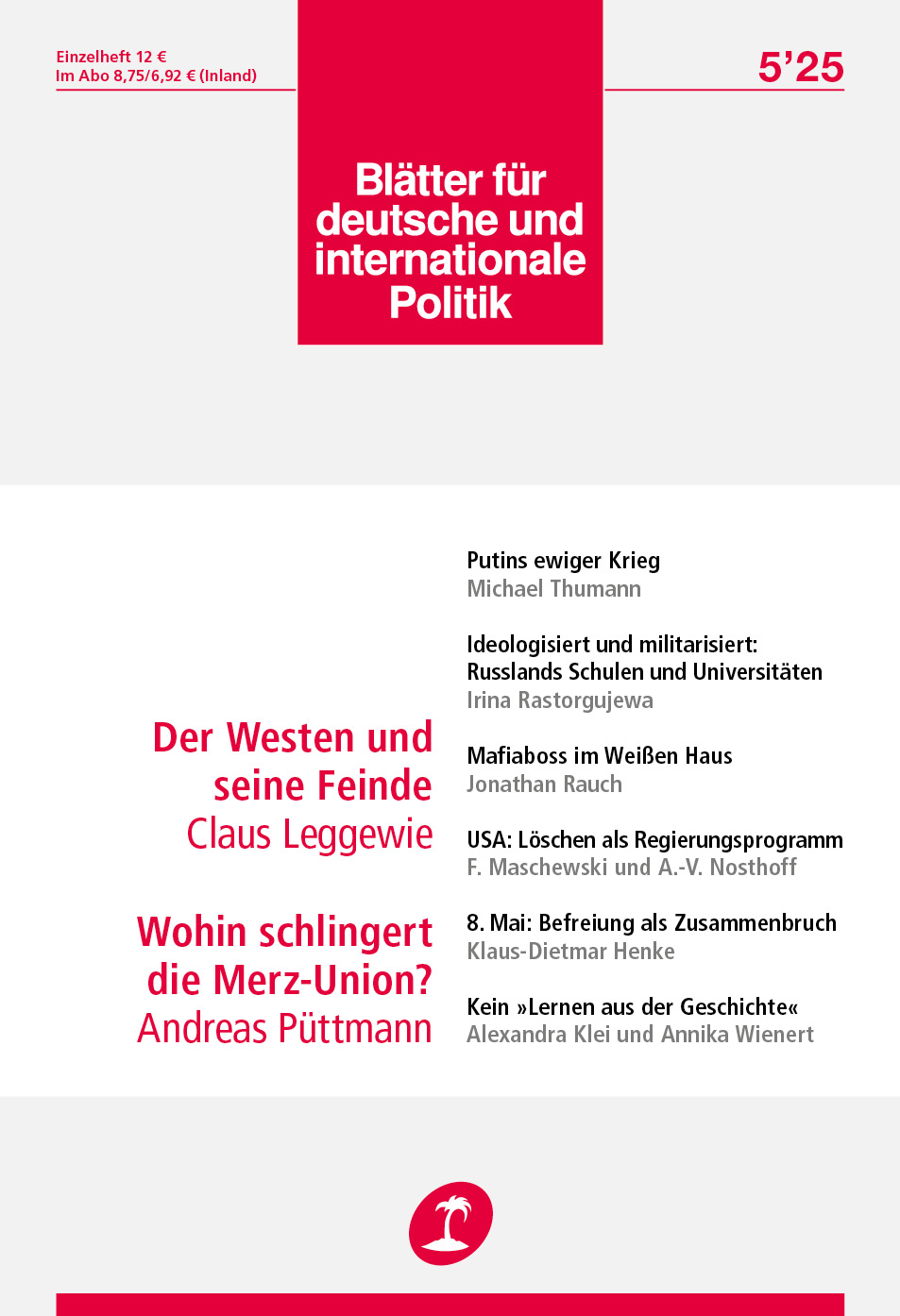Bild: Reinigungskraft im Bundestag. Die EU-Mindestlohn-Richtlinie könnte gekippt werden (IMAGO / Chris Emil Janßen)
Nach Jahren antisozialer Politik infolge der Finanzkrise von 20081 standen soziale Fragen in der vergangenen Legislatur der EU wieder weiter oben auf der Agenda. Zwischen 2022 und 2024 verabschiedeten das EU-Parlament und der Rat seit langem wieder mehrere soziale EU-Gesetze, darunter die Richtlinie über „angemessene Mindestlöhne in der Europäischen Union“, die Richtlinie „zur Beseitigung des geschlechtsspezifischen Lohngefälles“ sowie in letzter Minute vor den Europawahlen im Juni vergangenen Jahres die Richtlinien zur „Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Plattformarbeit“ und zu den „Sorgfaltspflichten von Unternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit“ (EU-Lieferkettengesetz). Nun aber drohen große Rückschritte, wie Nicolas Schmit, der sozialdemokratische Spitzenkandidat bei der Europawahl, bereits 2024 befürchtete.2
Das Jahr 2025 begann für das soziale Europa mit zwei Paukenschlägen. Am 14. Januar 2025 empfahl Nicholas Emiliou, ein Generalanwalt der EU, dem Europäischen Gerichtshof (EuGH), die Richtlinie über „angemessene Mindestlöhne in der Europäischen Union“ ersatzlos zu streichen, da das EU-Parlament und der Rat ihre gesetzgeberischen Kompetenzen überschritten hätten. Und am 26. Februar 2025 präsentierte die neue EU-Kommission einen Gesetzesvorschlag für eine umfassende „Omnibus”-Richtlinie, die das EU-Lieferkettengesetz wieder verwässern soll. Um „Bürokratie abzubauen”, sollten Konzerne laut Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen von sozialen und ökologischen Sorgfaltspflichten entlastet werden, auf die sich EU-Parlament und Rat erst im vergangenen Jahr geeinigt hatten.
Noch ist offen, ob es zum geplanten Abbau der sozialen und ökologischen Sorgfaltspflichten der Konzerne kommen wird, da progressive Kräfte – trotz des relativen Wahlsieges rechter Parteien in den EU-Parlamentswahlen – im Ministerrat weiterhin über eine Sperrminorität verfügen. Dagegen könnte die „historische“ Mindestlohnrichtlinie3, derzufolge Mindestlöhne als angemessen gelten, wenn sie mindestens 60 Prozent des mittleren gesamtwirtschaftlichen Lohns von Vollzeitbeschäftigten (Medianlohn) entsprechen, schon bald Geschichte sein. Denn in Kürze wird sich voraussichtlich herausstellen, ob der EuGH in seinem anstehenden Urteil der Argumentation von Generalanwalt Emiliou folgen wird oder nicht.4
Die Auseinandersetzung um die Mindestlohnrichtlinie ist politisch äußerst brisant. Seit 2009 verfolgt die EU nämlich eine Politik, die sich direkt auf die Lohn- und Tarifpolitik mehrerer Mitgliedstaaten auswirkt. Gemäß dem neuen Regime wirtschaftlicher Steuerung, das die EU nach der Finanzkrise einführte, um das Auseinanderbrechen der Eurozone zu verhindern, können die Kommission und der Rat der Finanzminister:innen die Zahlung von EU-Geldern an die Bedingung weitreichender Reformen knüpfen, inklusive Lohnkürzungen oder die Dezentralisierung von Flächentarifverträgen. Das EU-Parlament und der Rat der Arbeitsminister:innen verabschiedeten die Mindestlohnrichtlinie auch deshalb, um die antisoziale Stoßrichtung des Regimes der New Economic Governance (NEG) – das der EuGH in mehreren Gerichtsurteilen für rechtens erklärte5 –, zu korrigieren. Dann aber klagte die dänische Regierung gegen die Mindestlohnrichtlinie, da diese sich angeblich zu sehr in nationale Belange wie die Arbeitsentgelte und die Autonomie der Sozialpartner einmische.
Mindestlohnrichtlinie vor dem Aus?
Die ersten juristischen Analysen gehen dennoch davon aus, dass die Klage Dänemarks gegen die Mindestlohnrichtlinie nicht erfolgreich sein wird. Für Claire Kilpatrick und Marc Steiert vom Europäischen Hochschulinstitut in Florenz steht die Argumentation von Generalanwalt Emiliou auf tönernen Füßen. Sie weisen darauf hin, dass er die Entstehungsgeschichte der EU-Verträge, das geltende EU-Arbeitsrecht und die EuGH-Rechtsprechung vernachlässige. Bereits heute regelt das EU-Recht Fragen zum Arbeitsentgelt in einer Weise, die nach Emilious Auslegung von Artikel 153(5) des Vertrags über die Arbeitsweise der EU (AEUV) verboten wäre.
Dieser Artikel hat die EU jedoch nicht davon abgehalten, Richtlinien zu erlassen, die auch die Lohnpolitik betreffen. Die Entsenderichtlinie etwa führte den Grundsatz „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ ein. Vergleichbare Bestimmungen zur Lohnpolitik finden sich auch in den EU-Richtlinien zu atypischen Arbeitsverhältnissen (also für Beschäftigte mit Zeit-, Teilzeit- oder Leiharbeitsverträgen). Dazu kommen die Richtlinien zur Lohngleichheit von Mann und Frau, inklusive der jüngsten Richtlinie zur „Beseitigung des geschlechtsspezifischen Lohngefälles“, die mittlere und große Betriebe dazu verpflichtet, Lohngleichheitsanalysen durchzuführen und diese zu beseitigen, wenn unerklärbare Lohnunterschiede festgestellt werden. Der EuGH sollte daher an seinem etablierten Ansatz festhalten, den Ausschluss des Entgeltes von den gesetzgeberischen Kompetenzen der EU durch Art. 153(5) eng auszulegen, und die Klage gegen die Richtlinie ablehnen.6 Auch die Jurist:innen des Europäischen Gewerkschaftsbunds gehen davon aus, dass der EuGH der Klage kaum zustimmen wird.7 Sie argumentieren, dass die Richtlinie weder die Autonomie der Sozialpartner untergräbt noch die Lohnhöhe festlegt. Es gehe vielmehr darum, mit sozialpolitischen Maßnahmen allen Beschäftigten einen angemessenen Lebensstandard zu sichern. Dazu gehören Aktionspläne, um mehr Arbeitnehmende unter den Schutz von Tarifverträgen zu stellen. Zudem müssen Länder mit gesetzlichen Mindestlöhnen diese künftig regelmäßig erhöhen und dafür sorgen, dass sie existenzsichernd sind. Die Regierungen der Länder mit gesetzlichen Mindestlöhnen sind gemäß der Richtlinie außerdem verpflichtet, für deren Festlegung transparente Verfahren einzurichten, die auch die Sozialpartner einbeziehen. Zugleich verpflichtet die Richtlinie alle Staaten dazu, den Lohnschutz zu stärken, damit die Beschäftigten die ihnen rechtlich zustehenden Löhne auch erhalten.
Klage mit offenem Ausgang
Dennoch ist der Ausgang der Klage offen, denn hinter dem Angriff auf die Mindestlohnrichtlinie steht eine starke politische Lobby. Von Anfang an setzte der europäische Dachverband der Industrie- und Arbeitgeberverbände, Business Europe, alles auf die juristische Karte. Im Gesetzgebungsverfahren ist der Verband damit kläglich gescheitert. Noch im Herbst 2019 versicherten Vertreter:innen von Business Europe, dass sie jeden Vorschlag der Kommission in diesem Feld einfach blockieren könnten, zumal sie je einen dänischen und einen schwedischen Gewerkschaftsbund für gemeinsame Aktionen in Stockholm und Kopenhagen gegen eine Mindestlohnrichtlinie gewinnen konnten. In Brüssel, Straßburg und allen anderen europäischen Regierungen fanden die Argumente von Business Europe dagegen kein Gehör, abgesehen von der ungarischen Regierung.
Dies lag daran, dass die europäischen Arbeitgeberverbände ihre juristische Argumentation zuvor selbst untergraben hatten. So hatte Business Europe bereits im Juni 2010 explizit einen „europäischen Rahmen“ für die Lohn-, Arbeits- und Sozialpolitik verlangt, damit unternehmensfreundliche Reformen in EU-Mitgliedstaaten besser durchgesetzt werden können. Gleiches verlangten auch viele nationale Wirtschaftsverbände, inklusive der US-amerikanischen Handelskammer. Diese Interventionen ebneten den Weg dafür, was der ehemalige Kommissionspräsident José Manuel Barroso als „stille Revolution“ bezeichnete: einen Wandel von einem überwiegend marktorientierten (horizontalen) Modus der europäischen Integration hin zu einem stärker politisch geprägten (vertikalen) Ansatz des neuen supranationalen EU-Regimes länderspezifischer wirtschaftlicher Steuerung, das die EU nach der Finanzkrise einführte.
Diese Vorgeschichte ermöglichte es dem Europäischen Gewerkschaftsbund, die juristische Argumentation von Business Europe im EU-Gesetzgebungsverfahren auf den Kopf zu stellen: Wie kann der Verband behaupten, die EU sei nicht befugt, einen Rahmen für angemessene Mindestlöhne festzulegen, nachdem die EU ein Jahrzehnt lang Druck auf die Regierungen ausgeübt hatte, Mindestlöhne zu senken und Tarifverträge zu durchlöchern? Diese Argumentation der europäischen Gewerkschaften überzeugte die demokratischen EU-Gesetzgeber, zumal der EuGH zuvor alle Klagen von Gewerkschaften gegen die Beschlüsse des Rates der EU-Finanzminister:innen abgewiesen hatte, die die Zahlung von EU-Geldern an notleidende EU-Mitgliedstaaten von arbeitgeberfreundlichen Reformen ihrer Lohn-, Arbeits- und Sozialpolitik abhängig machte. Diese arbeitgeberfreundlichen EU-Interventionen schürten die EU-Skepsis der Beschäftigten und provozierten Proteste von Gewerkschaften und sozialen Bewegungen, auch auf transnationaler Ebene.8 Als Reaktion darauf unterstützten die Kommission, das EU-Parlament, 24 von 27 EU-Regierungen und sogar der französische Arbeitgeberverband MEDEF während der Coronapandemie die Verabschiedung der Mindestlohnrichtlinie – nicht nur, um faire Mindestlöhne zu sichern, sondern auch, um die Legitimität des EU-Integrationsprojekts in der Bevölkerung wiederherzustellen.
Trotz dieses breiten politischen Konsenses besteht die Gefahr, dass der EuGH die Richtlinie für nichtig erklären könnte. Generalanwalt Emiliou argumentiert, die EU-Verträge seien insbesondere im Bereich der Sozialpolitik unklar formuliert. Da die EU auf dem Prinzip der Rechtsstaatlichkeit beruhe, müsse der EuGH und nicht der demokratische Gesetzgeber diese Unklarheiten klären. In der Einleitung zu seiner Stellungnahme stellt er den Fall der Mindestlohnrichtlinie zudem als einen Konflikt zwischen zwei Zielen dar: einerseits dem der Förderung des sozialen Zusammenhalts und der Konvergenz der EU, andererseits dem der Schaffung einer Union, die der Vielfalt der nationalen Systeme und der Schlüsselrolle der Sozialpartner Rechnung trägt – zwei Ziele, die nicht leicht miteinander zu vereinbaren seien. Während die Verfolgung des ersten Ziels bedeuten würde, der EU mehr Macht zu geben, begünstige das zweite Ziel – das Emiliou priorisiert – die Auffassung, dass bestimmte sozialpolitische Entscheidungen allein Sache der Mitgliedstaaten sein müssen.
Betrachtet man den europäischen Integrationsprozess von seinen Anfängen bis hin zu den jüngsten, durch die Finanzkrise 2008 und den Covid-19-Notstand ausgelösten Entwicklungen, stellt man fest: Die Behauptung des Generalanwalts, bestimmte sozialpolitische Entscheidungen müssten „allein Sache der Mitgliedstaaten” sein, um die „Schlüsselrolle der Sozialpartner“ zu garantieren, ist reine Fiktion. Ob Gewerkschaften oder Arbeitgeber Maßnahmen auf nationaler oder auf EU-Ebene ergreifen, hängt nicht von abstrakten juristischen Prinzipien ab, sondern von der unternehmens- oder arbeitnehmerfreundlichen Ausrichtung der EU-Politik. Der EuGH sollte deshalb sein bevorstehendes Urteil über die Mindestlohnrichtlinie nicht auf die Vermutungen des Generalanwalts über die „wahre“ Bedeutung der Bestimmungen des EU-Vertrags stützen. Schließlich haben die Verfasser:innen der Einheitlichen Europäischen Akte und der EU-Verträge absichtlich unscharfe Formulierungen verwendet, um nationale und soziale Interessenkonflikte im Bereich der Sozialpolitik zu überwinden.9 Die Frage, ob die Richtlinie rechtmäßig ist, ist somit in erster Linie eine politische Frage, bei der es keine juristische Wahrheit gibt.
Gerade deshalb wäre der EuGH gut beraten, die Entscheidung über die Gültigkeit der Richtlinie den Teilnehmer:innen des demokratischen EU-Gesetzgebungsverfahrens zu überlassen. Dieses Verfahren schließt nämlich nicht nur das Europaparlament und den Rat der Arbeitsminister:innen ein, sondern auch die Sozialpartner und alle nationalen Parlamente: die Sozialpartner über den europäischen sozialen Dialog und die nationalen Parlamente über einen neuen Mechanismus der Subsidiaritätskontrolle. Übrigens war auch Nicholas Emiliou als damaliger ständiger Vertreter Zyperns im Rat der EU in ebendiesen demokratischen Prozess eingebunden, den er nun juristisch kippen will.
Sollte sich Emilious Meinung durchsetzen, wird der Skeptizismus gegenüber der EU unter Arbeiter:innen und einfachen Angestellten weiter wachsen. Sie werden nicht verstehen, warum die unternehmensfreundlichen Interventionen der EU zu Lohnkürzungen legal sind, eine arbeitnehmerfreundliche Richtlinie zu angemessenen Mindestlöhnen jedoch nicht.
1 Vgl. Roland Erne, Sabina Stan, Darragh Golden u.a., Politicising Commodification. European Governance and Labour Politics from the Financial Crisis to the Covid Emergency, Cambridge 2024.
2 Roland Erne, On a plane with Nicolas Schmit, in: „Social Europe”, 22.4.2024.
3 Torsten Müller und Thorsten Schulten, Die europäische Mindestlohn-Richtlinie: Paradigmenwechsel hin zu einem sozialen Europa, in: „Wirtschaft und Gesellschaft”, 3/2022, S. 335-364.
4 Vgl. die Beiträge von Nicolas Schmit, Nicola Countouris, Roland Erne u.a. auf dem Symposium on the Minimum Wages Directive Court Case, S&D Socialists and Democrats, youtube.com, 27.3.2025.
5 In der Rechtssache C-370/12 Thomas Pringle gegen die Regierung von Irland vom 27.11.2012 entschied der EuGH etwa, dass EU-Hilfen nur rechtmäßig seien, wenn sie an politische Auflagen gebunden sind. Damit interpretierte der EuGH Artikel 125 AEUV als Verpflichtung, die Mitgliedstaaten der „Logik des Marktes“ zu unterwerfen, obwohl der real existierende Binnenmarkt nicht so funktioniert wie angeblich in den EU-Verträgen vorgesehen. Zudem sind seit 2014 alle Struktur- und Investitionsmittel der EU an die Verfolgung einer „soliden Wirtschaftspolitik“ gebunden, wie sie in den länderspezifischen Empfehlungen des Rates der EU-Finanzminister:innen genauer bestimmt werden. Vgl. Erne, Stan, Golden u.a., a.a.O., S. 1, 28 und 86.
6 Claire Kilpatrick und Marc Steiert, A little learning is a dangerous thing: AG Emiliou on the Adequate Minimum Wages Directive (C-19/23, Opinion of 14 January 2025), EUI, LAW, Working Paper, 2025/02.
7 European Trade Union Confederation, Counter-Opinion to the Opinion of Advocate General Emiliou delivered on 14 January 2025 in the case Denmark v EP and Council, Brüssel, 24.2.2025.
8 Vgl. Roland Erne und Jörg Nowak, Ökonomischer Wettbewerbsdruck oder politische EU-Interventionen? Katalysatoren transnationaler sozioökonomischer Proteste in Europa, in: „WSI-Mitteilungen”, 5/2024, S. 363-370.
9 Vgl. Nicolas Jabko, Playing the market: A political strategy for uniting Europe, 1985–2005, Ithaca 2006.