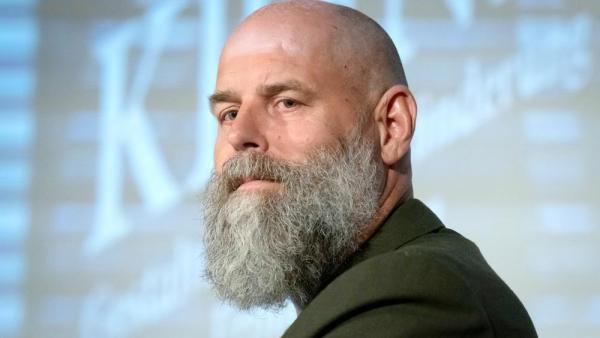Oder Plädoyer wider die Selbstaufgabe der Bundesrepublik
Aus allen (auch fast allen linken) Winkeln dröhnt uns derzeit die Mahnung zum Realismus entgegen.
Nun sei sie einmal geschehen, die Wiedervereinigung, wie ein Unwetter sei sie über uns gekommen, und fortan habe man sich damit abzufinden. Wer das nicht tue, katapultiere sich aus der Wirklichkeit heraus und begebe sich politischer Handlungsmöglichkeiten. Der Ton macht die Musik: Von Theo Sommer bis Klaus Hartung bekommen die Reden etwas Majestätisches, und mit nimmer ermüdender Hartnäckigkeit erinnern uns die journalistischen Auguren an einen monströsen staatlichen Vorgang, den wir auch ohne ihre theatralischen Mahnungen wohl kaum übersehen hätten. Warum dies fortwährende Bad im Banalen? Ich vermute, man macht sich selbst Mut - und verwischt Spuren.
Noch vor einem Jahr wäre ein Plädoyer für die Vereinigung beider deutscher Staaten (und erst recht für eine schnelle Vereinigung) ein Akt der Tempelschändung gewesen. Auch im Jahr der Menschenrechte - 200 Jahre nach der Französischen Revolution, fast zehn Jahre nach dem Auftakt der polnischen Opposition und unmittelbar vor dem politischen und ideologischen Ende des Ostblocks - galten hier der europäische und erst recht der deutsche Status quo als unantastbar und als eine zumindest noch sehr lange gültige vorletzte Weisheit.