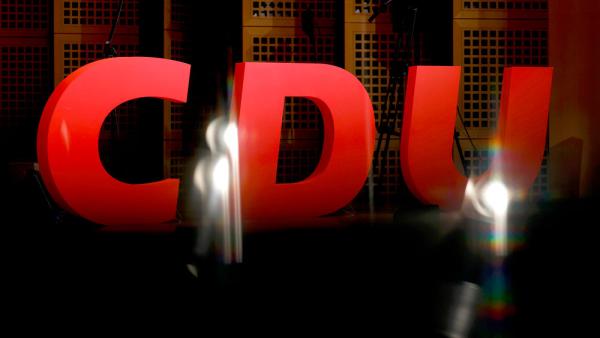Am 5. Oktober 1992 verunglückt die 18jährige Arzthelferin Marion P. um 14.00 Uhr auf dem Heimweg von der Arbeit. Mit ihrem Auto prallt sie gegen einen Baum. Zwanzig bis dreißig Minuten vergehen, bis Notärzte an der Unglücksstelle eintreffen, die lebensgefährlich verletzte Patientin intubieren und zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus einliefern können. Wegen der schweren Hirnverletzungen wird sie auf die Neurologische Intensivstation des Erlanger Universitätsklinikums verlegt. In den nächsten Tagen verschlechtert sich der Zustand der Patientin. Am 8. Oktober stellen Neurologen den Hirntod der Patientin fest.
Normalerweise wäre dies das Ende der Geschichte. Nach Feststellung eines Hirntodes werden die Geräte abgeschaltet, denn es ist sinnlos, Tote zu beatmen und künstlich zu ernähren. Marion P. jedoch ist schwanger. In ihrem Körper lebt ein Fötus, der bei Einstellen der künstlichen Beatmung sterben würde. Da man das Ungeborene aber für unversehrt hält und die sonstigen Körperfunktionen der Toten stabil sind, wird die künstliche Beatmung und Ernährung beibehalten. Man will das Leben des Fötus retten. Ein groß aufgemachter Artikel der "Bild-Zeitung" setzt nun eine breite öffentliche Diskussion über dieses Vorgehen der Ärzte in Gang.