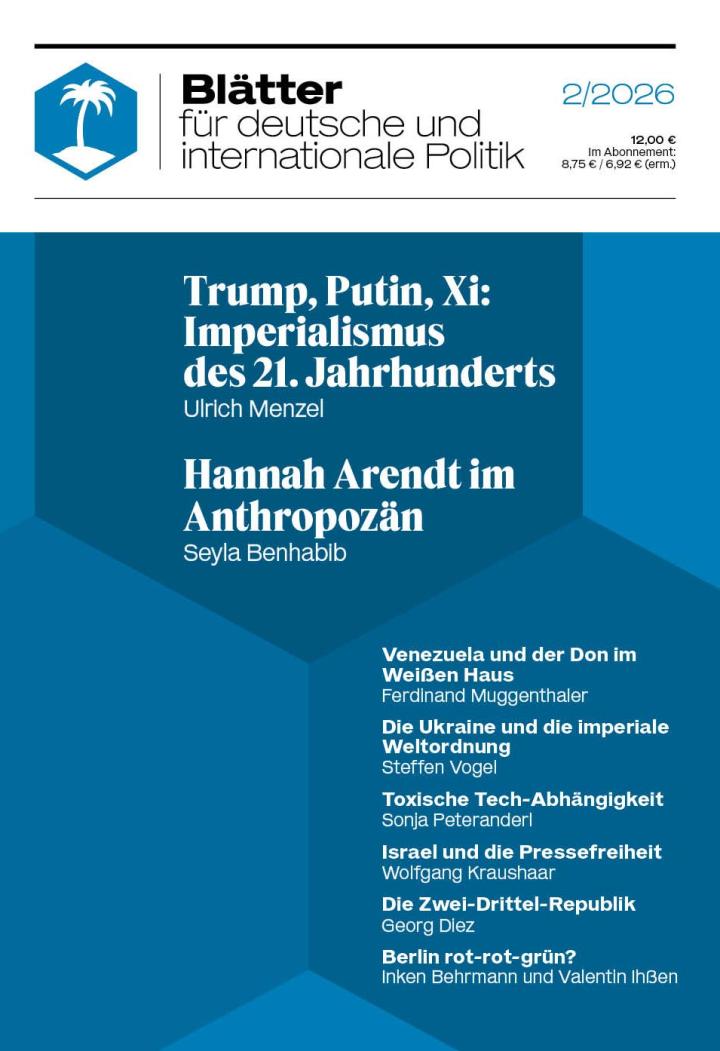Seit dem "Super Tuesday" steht so gut wie fest, dass die US-Demokraten John Kerry als ihren Präsidentschaftskandidaten nominieren werden. Wenn er die Wahl im November gewinnt, wird sich Amerikas Außenpolitik ändern. Doch in welcher Hinsicht? Lediglich in ihren Methoden oder auch in ihren Zielen?
Bei den Vorwahlen bestand Kerrys größtes Plus darin, dass man ihn als erfahrenen Politiker kennt, während es sich bei seinen beiden wichtigsten Rivalen in diesem Rennen um attraktive, aber unerprobte Nachwuchspolitiker handelte, beide relativ neu auf der nationalen Bühne. Dass Kerry im Vietnamkrieg gedient hatte, wies ihn als einen ernsthaften Menschen aus, der weiß, was Krieg ist, und sich selbst im Kampf bewährte – ein Mann, der sich mit den moralischen und politischen Dilemmata einer solchen Situation auseinandergesetzt hat und den Mut aufbrachte, sich gegen Konvention und Zeitgeist zu stemmen, als er den Krieg, in dem er selbst gekämpft hatte, verurteilte.
Nichts dergleichen lässt sich über Präsident Bush sagen. Auf welche Weise und in welchem Ausmaß dieser sich dem aktiven Militärdienst im Vietnamkrieg entzog, ist noch nicht abschließend geklärt, aber die Wahrheit könnte sich verheerend auf seine Wiederwahlchancen auswirken.
Nichtsdestotrotz beharrt er darauf, dass er ein "Kriegspräsident" sei. Nicht wenige seiner Gefolgsleute, die ebensowenig von der Realität des Krieges wissen wie Bush selbst, können gar nicht genug davon bekommen.