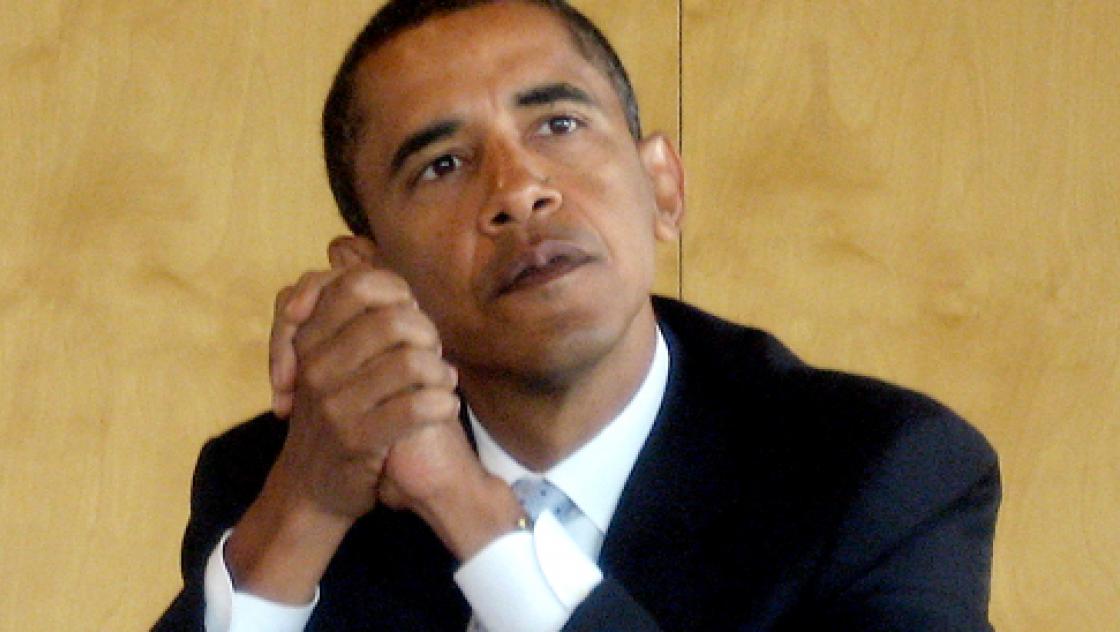Bis zu welchem Grad ist die Macht eines US-Präsidenten, über Krieg oder Frieden zu entscheiden, heute geschwächt, ja unter wichtigen Gesichtspunkten sogar in andere Hände übergegangen? Diesen Prozess hat Andrew J. Bacevich in seinem jüngst erschienenen Werk „Washington Rules: America’s Path to Permanent War“, einem ebenso glänzenden wie mutigen Buch, in aller Klarheit beschrieben. (Bacevich lehrt an der Boston University und gehörte zuvor viele Jahre lang der US-Army an.)
Man könnte den Vorgang als einen lautlosen Staatstreich gegen das Präsidentenamt bezeichnen, doch ein Staatsstreich geschieht vorsätzlich: Er bedarf eines verantwortlichen Akteurs, der den coup d’état auslöst, um einen bestimmten Zweck damit zu erreichen. Bacevich geht aber davon aus, dass es einen institutionellen oder geistigen Staatsstreich geben kann, der sowohl von außen kommen als auch innerhalb der Regierung selbst entstehen kann. Seine Besonderheit besteht darin, dass er eine Situation herbeiführt, in der ein Staats- oder Regierungschef nicht länger über die Freiheit verfügt, so zu handeln, wie er vielleicht handeln möchte, weil ihm alle Türen außer einer einzigen verschlossen wurden.
Das geläufigste und meistzitierte Beispiel hierfür kommt aus Deutschland. Ich meine die Kriegsplanung des kaiserlichen Generalstabs von 1914.