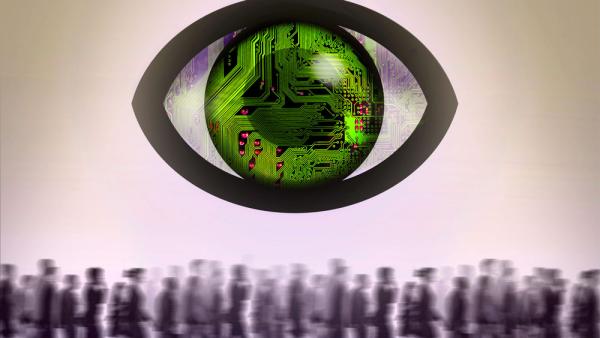Nachdem nun das große Aufatmen über den Ministerwechsel im Verteidigungsministerium vorüber ist und der neue Amtschef seine Arbeit aufgenommen hat, ist es an der Zeit, eine Eröffnungsbilanz der Ära de Maizière vorzulegen. Der Minister hat gepunktet mit seiner nüchternen Bestandsaufnahme, seinem Auftreten und seinen ersten Vorlagen. Gleichwohl sollte man sich nicht darüber hinwegtäuschen, dass hier ein Modellversuch ersten Ranges abläuft, dessen eigentliche Versuchsleiterin an der Spitze der Exekutive sitzt, aber unbeteiligt bleibt.
Die Versuchsprämisse lautet: Sicherheitspolitische Positionen materialisieren sich in den Streitkräften; sie werden sozusagen in Strukturen gegossen und ins Gelände geschrieben. Die aktuelle Versuchsanordnung dagegen lässt sich etwa so beschreiben: Was geschieht, wenn die Prämissen unklar sind? Wenn die Reform also, um Ulrike Guérot zu zitieren, in einem „strategischen Vakuum“ stattfindet, weil sich Deutschland über seine sicherheitspolitische Rolle in Europa und der Welt gar nicht im Klaren ist?[1] Die Folgen lassen sich auch im – bisher erkennbaren – Design der nun angeschobenen „Neuausrichtung“ betrachten. Sie betreffen zum einen die strategische Ziel- und Willensklarheit in der Außen- und Sicherheitspolitik, zum anderen die staats- und gesellschaftspolitische Komponente des Reformprojekts.