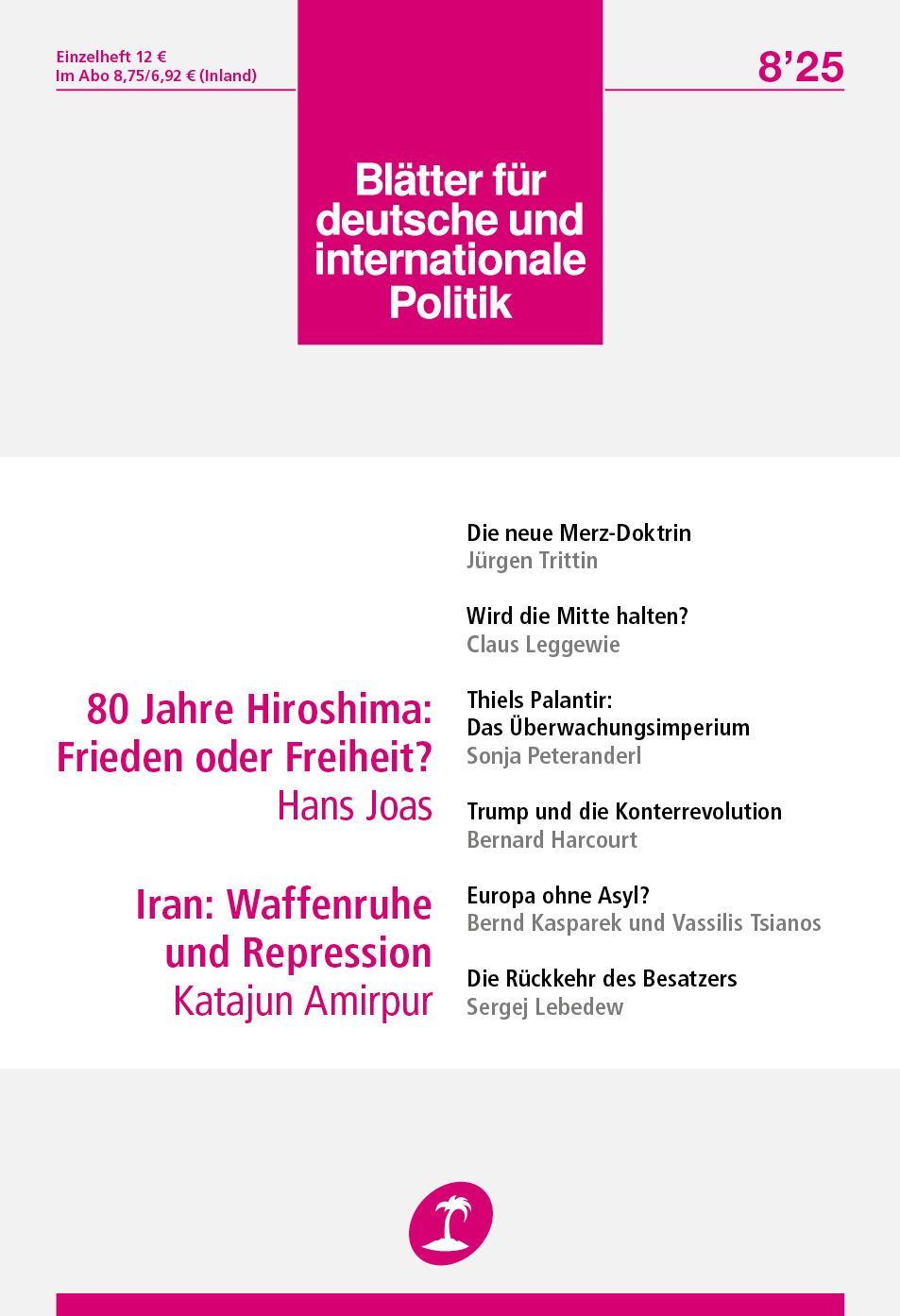Wie sich die deutsche Polizei von Peter Thiels Palantir-Software abhängig macht
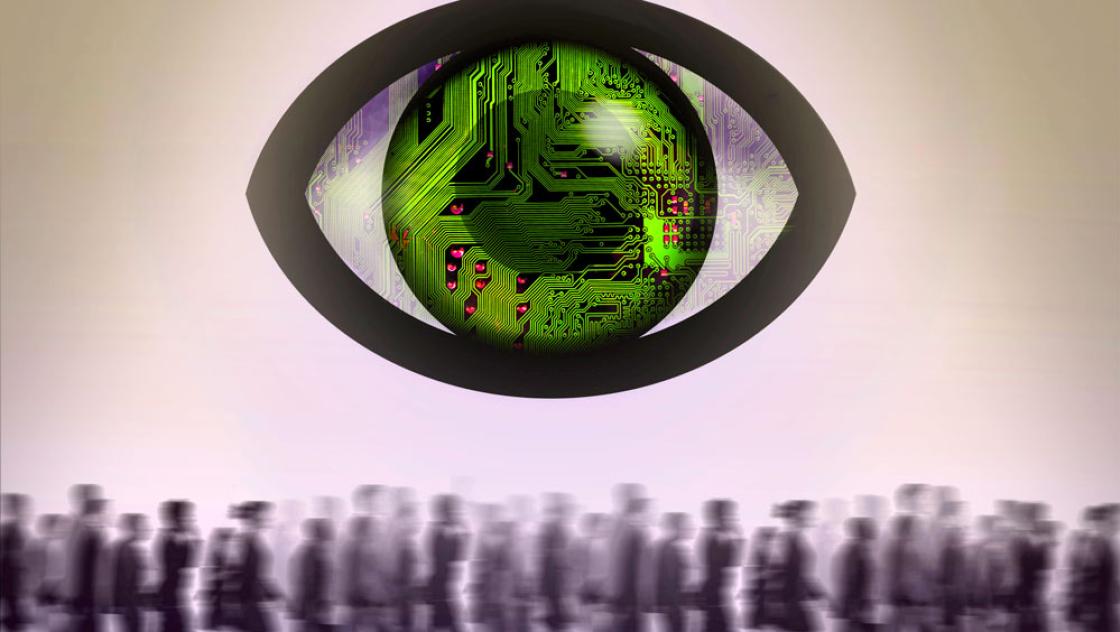
Bild: Symbolbild: Überwachung (IMAGO / Westend61)
Als in Los Angeles im Juni zehntausende Menschen gegen die Massenabschiebungen der Trump-Regierung auf die Straßen gehen, patrouillieren hoch oben am Himmel MQ-9-Predator-Aufklärungsdrohnen der US-Grenzschutzbehörde CBP. Technologien, die in Kriegen, Konflikten oder an der Grenze zu Mexiko erprobt und weiterentwickelt wurden, kommen nun zunehmend auch im Inneren der USA zum Einsatz – etwa um Proteste oder Migrant:innen zu überwachen. Der US-Tech-Konzern Palantir entwickelt für US-Präsident Donald Trump gerade „ImmigrationOS”, eine 30 Mio. Dollar teure Plattform, die Daten zu Migrant:innen zusammenzieht, ihren Aufenthaltsort fast in Echtzeit trackt und so Festnahmen und Massenabschiebungen beschleunigen soll – sie soll die digitale Architektur für Trumps in Teilen rechtswidrige Migrationspolitik bilden. Expert:innen warnen, dass es nicht bei der Massenüberwachung und Verfolgung von Migrant:innen bleiben dürfte. Künftig könnten alle US-Amerikaner:innen, jede:r, die oder der sich in den USA aufhält, über detaillierte, personenbezogene Profile überwacht werden. Erst im März kündigte Trump per Dekret an, dass „Informationssilos”[1] der Ministerien abgeschafft werden sollen, angeblich um Korruption zu bekämpfen: Daten, die zu unterschiedlichsten Zwecken erhoben wurden, sollen künftig über alle staatlichen Stellen hinweg ausgetauscht werden können – ein auf Palantir zugeschnittener Auftrag.
Palantir ist einer der größten Profiteure des gegenwärtigen politischen Umbruchs in den USA: Der Hype um KI, Überwachungs- und Kriegstechnologie, vor allem aber die Nähe des Paypal- und Palantir-Mitgründers und Tech-Multimilliardärs Peter Thiel zur Trump-Regierung treiben die Börsenkurse des Unternehmens in die Höhe. Die 2003 auch mit CIA-Geldern gegründete Firma ist derzeit rund 335 Mrd. US-Dollar wert. Thiel, ein radikaler Libertärer, gilt als mächtiger Strippenzieher. 2009 schrieb er in seinem Manifest „The Education of a Libertarian“ (Die Erziehung eines Libertären), er „glaube nicht mehr, dass Freiheit und Demokratie miteinander vereinbar sind“.[2] Nachdem sein Plan, autonome Steuerenklaven im Meer zu gründen, nicht aufging, scheint er auf die Unterwanderung der ihm verhassten Demokratie umgeschwenkt zu sein, die Zerstörung der Regulierungsbehörden von innen – mit Trump als Mittel zum Zweck. Thiel war der einzige aus dem Silicon Valley, der Trump bereits 2016 im Wahlkampf unterstützte, später wurde er zu seinem Berater. Er trieb den intellektuellen Rechtsruck in den USA voran, förderte radikale republikanische Kandidaten und ermöglichte auch die Karriere des heutigen Vizepräsidenten JD Vance. Die US-Regierung ist heute Palantirs wichtigster Kunde. Während Sozial- und Gesundheitsprogramme gekürzt werden, fließen gegenwärtig Milliarden in KI-Investitionen, Aufrüstung und Kriegstechnologie.
Palantir hat sich dabei mit Software, die riesige Datenmengen nach Mustern durchforstet, Querverbindungen zieht und teils auch Zukunftsprognosen erstellt, quasi ein Monopol geschaffen. Palantir-Software sei „designt für Totalüberwachung“ und damit „inkompatibel mit einer Demokratie“, warnte kürzlich die deutsche Politikerin und Publizistin Marina Weisband in einem „Panorama“-Interview.[3] Die Anwendungen des umstrittenen Konzerns werden heute von Geheimdiensten, Polizeien, Militärs und Unternehmen weltweit genutzt – darunter zunehmend auch von deutschen Polizeibehörden. Gerade wird hierzulande wieder die bundesweite Einführung von Palantir-Polizeisoftware diskutiert. Doch was bedeutet es, wenn die Softwareprodukte eines US-Konzerns, der eine eigene politische Agenda verfolgt, zu einem zentralen Steuerungselement für sicherheitsrelevante Institutionen, Entscheidungen und Einsätze werden?
„Wir machen uns abhängig von einer amerikanischen Firma, deren Mitgründer Peter Thiel durch demokratiefeindliche Äußerungen auffällt und die enge Verbindungen zur US-Regierung und zur CIA hat“, kritisiert Martin Kirsch, Vorstandsmitglied der Berufsvereinigung Polizei Grün. „Niemand weiß, ob morgen die Abhängigkeit von Palantir schon als Druckmittel eingesetzt wird.”[4] Kirsch zufolge habe die Politik es in den vergangenen Jahren versäumt, europäische Softwarefirmen aufzubauen, die in der Lage seien, ähnlich komplexe Alternativen zu liefern.
In Deutschland nutzen drei Bundesländer bereits Polizeisoftware, die auf der Palantir-Anwendung „Gotham“ aufbaut – und künftig werden es wohl noch mehr sein. Hessen testete „hessenDATA“ bereits 2017 und überführte die Software 2018 in den Echtbetrieb. Nordrhein-Westfalens System „Datenbankübergreifende Recherche und Analyse“ (DAR) unterstützt seit Mai 2022 polizeiliche Ermittlungen. In Bayern läuft das „Verfahrensübergreifende Recherche- und Analysesystem“ (VeRA) seit 2022 im Test- und seit Ende 2024 im Echtbetrieb – die Polizei hatte das Tool aber offenbar schon während der Testphase für Abfragen genutzt. Die Palantir-Software zieht je nach Fall riesige Datenmengen aus polizeiinternen und externen Quellen zusammen, wie Polizeidatenbanken, Ausländer- oder Waffenregister, Telekommunikationsüberwachung, Funkzellenauswertungen oder Abfragen zu sozialen Netzwerken. Das Programm fügt Puzzlestücke zusammen, visualisiert Querverbindungen und Netzwerke. So entstehen nicht nur dichte personenbezogene Profile, sondern auch neue Verdachtsmomente. Dem bayerischen Landeskriminalamt zufolge könnten mit der Software „Anfragen, die früher mühsam durch Einzelabfragen dezentral bei verschiedenen Stellen in den verschiedenen Anwendungen erfolgen mussten und so teils mehrere Tage in Anspruch nahmen, durch die automatisierte, parallele Recherche in mehreren Anwendungen und landesweit bereits nach wenigen Minuten umfassend beauskunftet werden“. Diese Zeitersparnis sei „für eine effektive Abwehr von schwerwiegenden Gefahren von entscheidender Bedeutung”.[5]
Datenanalyse mit Sicherheitsrisiko – und ohne gesetzliche Grundlage
Zwar arbeiten die deutschen Polizeien schon seit zwei Jahrzehnten daran, ihre IT-Landschaft zu modernisieren und zu vereinheitlichen, doch die digitale Transformation kommt nur schleppend voran. Bisher ist die vom Föderalismus geprägte IT-Architektur der deutschen Polizeien dem Bundesinnenministerium zufolge „geprägt von Eigenentwicklungen, Sonderlösungen, unterschiedlichen Dateiformaten und Erhebungsregeln“.[6] Die Erkenntnisse der Sicherheitsbehörden in Bund und Ländern sowie zwischen Polizeien und Nachrichtendiensten sind der „Initiative für einen handlungsfähigen Staat” zufolge nicht ausreichend miteinander verknüpft. „Dieser Mangel wird nach jedem Attentat beklagt”, heißt es in einem 2025 veröffentlichten Bericht der Initiative zum Reformbedarf –, „geändert hat sich bisher wenig”.[7] Mit dem Programm „P20“ sollen Systeme und Prozesse zu einem einheitlichen Verbundsystem zusammengeführt werden, das den Datenaustausch erleichtert. 2019 einigten sich Bund und Länder auf einen Fonds in Höhe von 300 Mio. Euro für die moderne Polizei-IT-Infrastruktur.
Unionspolitiker wie der heutige Bundeskanzler Friedrich Merz und Bundesinnenminister Alexander Dobrindt setzen sich seit Jahren dafür ein, Palantir-Software im Rahmen von „P20” bundesweit verfügbar zu machen. Doch 2023 hatte das damals noch SPD-geführte Bundesinnenministerium den Vorstoß, der unter dem Namen „Bundes-VeRA” lief, gestoppt. „Die Bundestagswahl 2025 brachte wieder Bewegung in die Palantir-Anschaffungspläne“, beobachtet Simon Egbert, der an der Universität Bielefeld zu digitaler Polizeiarbeit forscht.[8] Unter neuer Leitung sei das Innenministerium deutlich offener gegenüber Bundes-VeRA und werde finanzielle Mittel für die Anschaffung von Gotham freigeben. Baden-Württemberg stünde offenbar kurz davor, Gotham einzuführen, ebenso habe Rheinland-Pfalz kürzlich ein Gesetz verabschiedet, das eine Grundlage für Ermittlungen per Big Data-Analyse schafft. Auch Berlin und Sachsen-Anhalt seien Egbert zufolge nicht mehr weit weg von einer „Entscheidung pro Palantir“. Darüber hinaus forderte auch der Bundesrat im März eine gemeinsam genutzte automatisierte Datenanalyseplattform für die Länderpolizeien – mehrere Bundesländer sprachen sich aber gegen den Einsatz der Palantir-Software aus. Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern betonten dem Plenarprotokoll zufolge, „dass die zentrale Anforderung der digitalen Souveränität für jedes IT-Produkt der automatisierten Datenanalyse gelten muss und dass dies eine Nutzung von Produkten des marktführenden, US-amerikanischen Anbieters Palantir [...] für die Zukunft als Standardanwendung ausschließt”. Möglichkeiten der Einflussnahme durch ausländische Staaten, etwa über eine Beeinträchtigung des Herstellersupports oder Datenausleitungen müssten ausgeschlossen werden. Jedes Bundesland kann jedoch weiterhin eigenständig Palantir-Software anschaffen – Bayern hat 2022 einen Rahmenvertrag mit dem US-Konzern ausgehandelt, dem weitere Bundesländer und auch der Bund beitreten können.
Die Befürchtung, dass Palantir eine „Hintertür“ im System eingebaut haben könnte, über die der Konzern sensible Polizeidaten heimlich abgreifen kann, besteht seit der Einführung der Software bei deutschen Polizeien. 2023 ließ die Bayerische Polizei ihre „VeRA“-Software daher vom Fraunhofer-Institut für Sichere Informationstechnologie in Darmstadt prüfen. Das Institut analysierte den Quellcode und lieferte der Polizei zufolge eine „umfassende Schwachstellenanalyse”. Zugriffsmöglichkeiten fanden die Sicherheitsforscher zwar nicht, aber die Auswertung ist mit Verweis auf Sicherheitsbedenken der Polizei sowie Palantir-Geschäftsgeheimnisse als Verschlusssache eingestuft.
„Auch wenn die Software lokal gehostet wird und keinen Zugang zum Internet hat, ist trotzdem nicht auszuschließen, dass sie Fehler macht und im schlimmsten Fall doch Hintertüren oder Leaks drohen, gerade wenn ein Anbieter mit Geheimdiensten oder autoritären Staaten zusammenarbeitet“, sagt die Juristin Franziska Görlitz von der Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF). Zudem habe ein Marktführer wie Palantir großen Gestaltungsspielraum bei den Preisen. Zum Anschaffungspreis kommen weitere Lizenzen, Schulungen, Beratung, Wartung und die Bereitstellung neuer Funktionen hinzu – so explodieren die Kosten im Verlauf der Zeit. Die GFF hat bereits mehrere Verfassungsbeschwerden eingereicht, denn Palantir-Software wurde ohne ausreichende oder überhaupt eine gesetzliche Grundlage eingeführt. In die Datenanalysen flössen „in großem Umfang auch Daten von Menschen ein, die selber keinen Anlass dafür gegeben haben, in so eine Datenanalyse zu geraten“, so Görlitz. Wenn man Opfer einer Straftat werde, eine Anzeige erstatte oder bei der Polizei einen Hinweis gebe, könnten diese Informationen in die Palantir-gestützten Datenanalysen gelangen. Zugleich haben Betroffene – darunter oft diskriminierte Bevölkerungsgruppen, die in polizeilichen Datenbanken überrepräsentiert sind –, keine Möglichkeit, sich zu wehren, da sie nichts davon wissen. In Hessen wurde „hessenDATA” anfangs nicht nur bei schwerer oder organisierter Kriminalität oder Terrorismus eingesetzt, sondern auch zur Aufklärung von Einbrüchen – dabei wurden selbst Daten von Unfallzeugen ausgewertet. Auch Bayern nutzt „VeRA” offenbar nicht nur bei schweren Verbrechen. 2023 entschied das Bundesverfassungsgericht nach Verfassungsbeschwerden der GFF, dass die Gesetze zum Einsatz von Datenanalysesoftware bei der Polizei in Hessen und Hamburg in der damaligen Form verfassungswidrig waren. Auch die überarbeitete hessische Norm hält die GFF noch nicht für verfassungskonform und hat erneut Verfassungsbeschwerde eingelegt. Eine weitere Verfassungsbeschwerde gegen das Polizeigesetz in Nordrhein-Westfalen ist anhängig.
Scoring: Die Verbrechen der Zukunft kalkulieren
Palantir vertreibt weltweit auch KI-Komponenten und Scoring-Verfahren, die Gewaltbereitschaft, künftige Verbrechen, oder Rückfallwahrscheinlichkeiten von Personen kalkulieren sollen. Die deutsche Polizei setzt Palantir dazu bisher noch nicht ein. Doch ihre Bundesratsinitiative zur Einführung einer behördenübergreifenden Analysesoftware begründen Berlin und Sachsen-Anhalt auch damit, dass in jüngster Zeit „oftmals Personen mit psychischen Auffälligkeiten als Täter von Gewalttaten“ in Erscheinung getreten seien. „Um solche schweren Straftaten besser erkennen und erfassen zu können, müssen personenbezogene Verhaltensmuster und Risiken rechtzeitig festgestellt, analysiert und bewertet werden.“[9] Auch ein umstrittenes Zentralregister für psychisch erkrankte Menschen zur Gewaltprävention wird derzeit diskutiert.[10]
Von 2013 bis 2018 testete Palantir in New Orleans bereits heimlich ein System zur Prognose von Waffengewalt. Analysten der Stadtverwaltung experimentierten damals mit Palantir-Software, um das Risiko zu kalkulieren, dass Menschen Opfer oder Täter bei Schießereien werden. Der Lokalpolitiker Jason Williams kritisierte damals die Intransparenz des Vorgehens und der Algorithmen: „Ich würde keine Pille aus einer undurchsichtigen, bernsteinfarbenen Flasche nehmen, die kein Etikett hat“, warnte er.[11] Auch in Europa scheint Palantir zumindest zu versuchen, Risk-Scoring-Verfahren zu vermarkten, obwohl diese gemäß dem AI-Act der EU wenn überhaupt, dann nur in sehr engen Grenzen angewendet werden dürften, so die Einschätzung von Expert:innen. Der britischen Regierung bot die Firma an, Rückfallwahrscheinlichkeiten von inhaftierten Menschen zu prognostizieren. Solche Verfahren sind jedoch umstritten, weil dabei häufig diskriminierende Verzerrungen auftreten – die dann als Grundlage für polizeiliche Entscheidungen dienen. Gerade treibt Palantir auch die Integration von sogenannten Large Language Models (LLM) in Produkte voran.[12] Soldaten können damit etwa über einen KI-Chatbot Lageeinschätzungen und Prognosen abrufen und sich Angriffspläne erstellen lassen. Die Nutzung solcher KI-Komponenten wird nach Einschätzung von Egbert auch in Deutschland mit der Zeit zunehmen. Der Forscher geht davon aus, dass die deutschen Polizeibehörden Gotham zumindest für eine Überbrückungszeit anschaffen werden – und parallel eine eigene Plattform entwickeln. „Meine Vermutung ist, dass Gotham dann aber eine mindestens mittelfristige Übergangslösung wird, weil die Eigenentwicklung nicht voranschreitet“, so Egbert.
Derweil radikalisiert sich der US-Konzern weiter. Die letzten offenen Briefe von Palantir-CEO Alexander Karp an die Aktionäre klingen kämpferisch: „Unser Interesse an der Aufrüstung der Vereinigten Staaten und daran, sicherzustellen, dass ihre Verteidigungs- und Nachrichtendienste über Softwarekapazitäten verfügen, die weitaus leistungsfähiger sind als die ihrer Widersacher, wurde jahrelang als politisch heikel und unvernünftig abgetan. […] Wir […] wurden aus dem [Silicon] Valley verstoßen und beinahe abgeschrieben. Mittlerweile sieht es jedoch so aus, als hätte das Valley die Kehrtwende geschafft und damit begonnen, unserem Beispiel zu folgen.” Karp, der früher noch als eine Art ideologisches Gegengewicht zu Peter Thiel gehandelt wurde und lange die Demokraten unterstützte, lobt heute offen Präsident Trump und fordert, „der Westen” müsse militärisch Stärke zeigen. Firmenangaben zufolge sind Palantirs Einnahmen im öffentlichen Sektor allein in den ersten drei Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahr um 45 Prozent auf 373 Mio. US-Dollar gestiegen – Karp zufolge vor allem „für die Planung und Durchführung von Spezialeinsätzen und anderen militärischen Operationen sowie für die Bewertung und Auswahl von Zielen des amerikanischen Verteidigungssektors”. Im Mai gab das US-Verteidigungsministerium überdies bekannt, einen laufenden Vertrag für die Nutzung der Militärsoftware „Maven Smart System” um 795 Mio. US-Dollar zu erhöhen. Die KI-basierte Software hilft bei der logistischen Planung von Militäreinsätzen, analysiert Muster in Bild- und Drohnenvideoaufnahmen, um Objekte und Personen zu erkennen, Ziele zu markieren, zu verfolgen und Angriffe zu planen. Palantir-Datenauswertungen spielen eine zentrale Rolle bei der Entscheidung über Leben und Tod in Kriegseinsätzen, wie derzeit in Gaza. „Unser Produkt wird gelegentlich verwendet, um Menschen zu töten“, gab CEO Karp einmal zu. Er habe sich auch selbst schon gefragt: „Wenn ich jünger wäre, würde ich dann gegen mich protestieren?”[13]
Das dystopische Potenzial der Technologie ist sogar Teil des eigenen Gründungsmythos. Die Firma ist nach einem Palantír, einem der „Sehenden Steine” aus Tolkiens Fantasy-Sage „Der Herr der Ringe” benannt. Die Kristallkugeln offenbaren Blicke in andere Gegenden und Zeiten und ermöglichen eine Kommunikation über große Entfernungen hinweg. Sie sind mächtige Werkzeuge, die in der Geschichte in die Hände des bösen Herrschers Sauron geraten und von diesem missbraucht werden: Er täuscht mit den die Wahrheit verzerrenden Visionen des Palantírs seine Gegner, um die eigene Macht auszubauen. Auch in der Realität bildet die Palantir-Software ein mächtiges Werkzeug – und ein Sicherheitsrisiko, das, nicht nur in den Händen von Autokraten, Demokratie und Freiheit auszuhöhlen droht.
[1] Stopping Waste, Fraud, and Abuse by Eliminating Information Silos, whitehouse.gov, 20.3.2025.
[2] Peter Thiel, The Education of a Libertarian, cato-unbound.org, 13.4.2009.
[3] Johannes Edelhoff, Petra Blum, Florian Flade und Lorenz Jeric, Polizeisoftware Palantir: Fluch oder Segen?, ndr.de, 19.6.2025.
[4] Im Gespräch mit der Autorin am 7.7.2025.
[5] E-Mail des Bayerischen Staatsministerium des Innern, 12.6.2025.
[6] Das Programm „Polizei 20/20“, bka.de.
[7] Initiative für einen handlungsfähigen Staat – Reformen für eine starke Demokratie, ghst.de.
[8] Im Gespräch mit der Autorin am 1.7.2025.
[9] Drucksache 58/25, bundesrat.de, 5.2.2025.
[10] Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde e. V. , Kein Zentralregister für Menschen mit psychischen Erkrankungen, dgppn.de, 7.1.2025.
[11] Ali Winston, Palantir has secretly been using New Orleans to test its predictive policing technology, theverge.com, 27.2.2018.
[12] Vgl. Matthew Gault, Palantir claims applying generative AI to warfare is „ethical“ without addressing problems of LLMs, business-humanrights.org, 26.4.2023.
[13] James Bamfort, How US Intelligence and an American Company Feed Israel’s Killing Machine in Gaza, thenation.com, 12.4.2024.