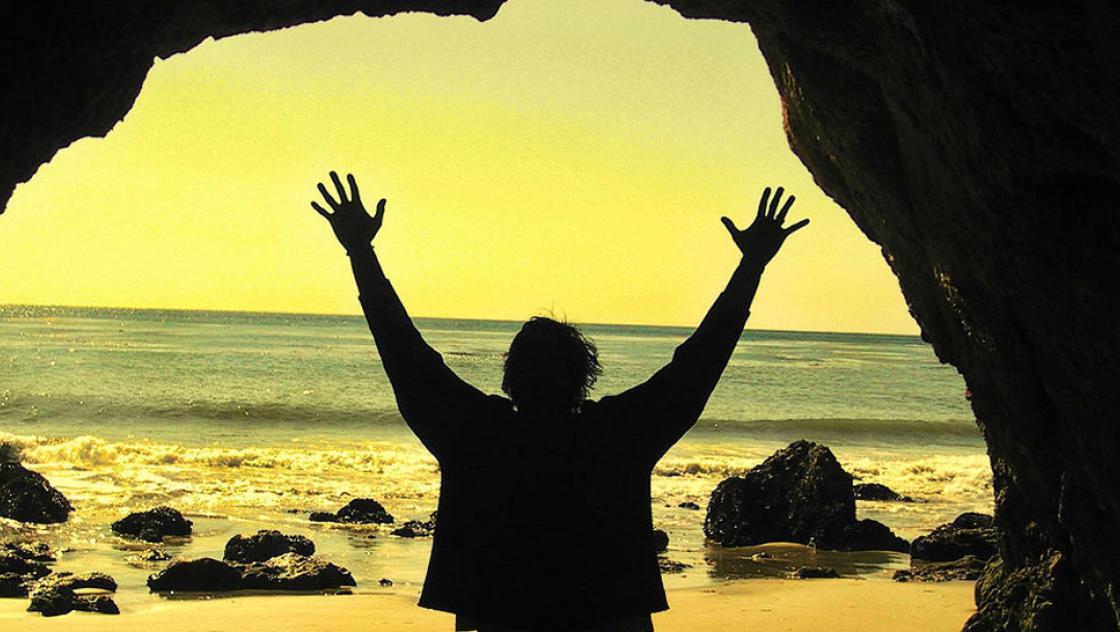Am Vorabend der Französischen Revolution sagte der Abgeordnete des revolutionären Nationalkonvents Louis Antoine de Saint-Just, dass „das Glück“ eine „neue Idee in Europa“ sei. Und in der Tat handelte es sich dabei im Gegensatz zur himmlischen Glückseligkeit (béatitude) und zum öffentlichen Wohl (félicité) um ein materielles und individuelles Wohlergehen – und damit bereits um einen Vorboten des Bruttoinlandsprodukts pro Kopf der Ökonomen, dessen ethische Dimension gering, ja fast nichtig ist.
Das spiegelt den durch die Aufklärung (Lumières, Enlightenment, Illuminismo) bewirkten Bruch wider, der die zeitgenössische sogenannte Gelehrtenrepublik umtreibt, bevor er das Leben der Völker Europas im Galopp unter dem Namen „esprit du siècle“, verkörpert in Napoleon Bonaparte, durcheinanderwirbelt. Diese große kosmopolitische Bewegung bedeutete einen radikalen Bruch mit der christlichen Ökumene (jenem angeblich dunklen und obskuren Mittelalter), deren Ideal des guten Lebens in der Sprache der Gebildeten durch das lateinische beatitudo ausgedrückt wurde: „O beata solitudo, o sola beatitudo“ – „O selige Einsamkeit, o einziges Glück“. Die Glückseligkeit war hier ausgesprochen spirituell, himmlisch gar, immateriell und kollektiv, als Gemeinschaft der Heiligen.