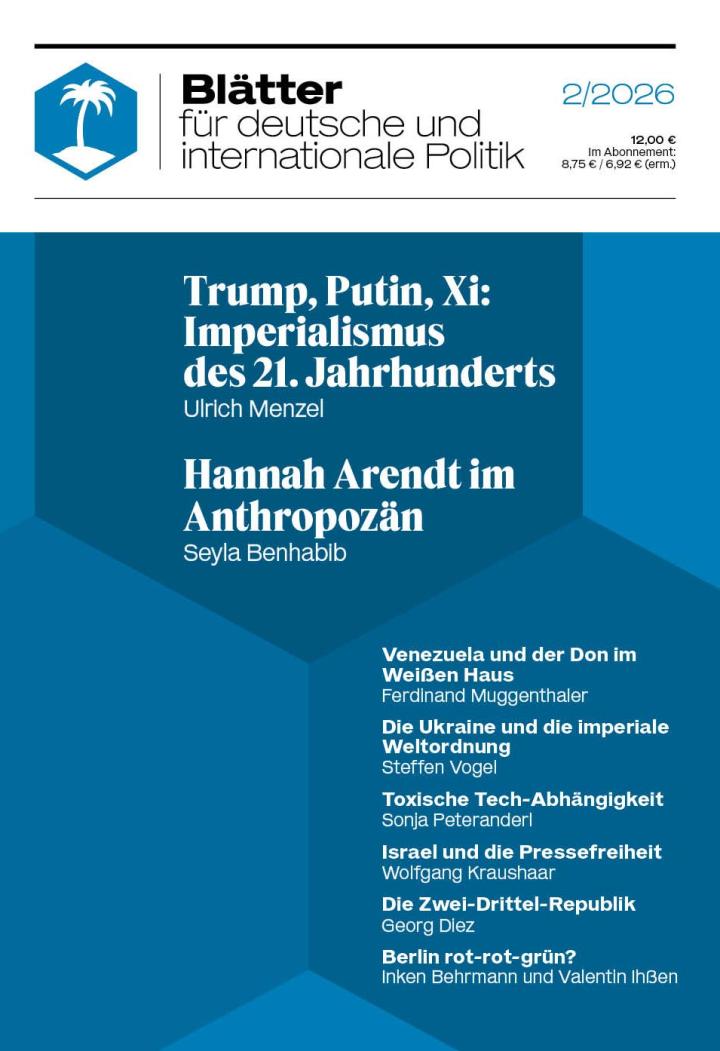Bild: Jannes van den Wouwer / Unsplash
Drei Jahre hat es gedauert, jetzt aber ist die Brexit-Debatte entschieden – zumindest auf den ersten Blick. Die Briten jedenfalls sind im vergangenen Dezember in Massen auf die frechste Lüge des Wahlkampfs hereingefallen. Millionen haben geglaubt, was die flotteste Parole verhieß: „Get Brexit done!“, hatten die Konservativen gefordert, zu Deutsch: „Den Brexit durchziehen!“ Und genau das wollen all jene, die Boris Johnson letztlich zu einer überwältigenden Mehrheit verholfen haben.
Schon am 20. Dezember, und damit gerade einmal eine Woche nach der Wahl, wurde das Austrittsabkommen im britischen Parlament in zweiter Lesung angenommen. Nachdem auch das Europäische Parlament seinen Segen erteilt hatte, konnte Großbritannien am 31. Januar in aller Form den Austritt aus der EU vollziehen. Und Millionen Wähler der Tories glauben allen Ernstes, damit sei die Sache ausgestanden, sie hätten den Brexit endlich über die Bühne gebracht und könnten sich anderen Dingen zuwenden.
Doch weit gefehlt. Seit dem Austritt befinden sich das Vereinigte Königreich und die Europäische Union in der vertraglich vereinbarten Übergangsperiode. Diese dauert bis Ende Dezember 2020 an, kann auf Antrag aber im gegenseitigen Einvernehmen um ein oder zwei Jahre verlängert werden. Bis zum 31. Dezember 2020 ändert sich zunächst wenig im gegenseitigen Verhältnis. Alles läuft weiter wie bislang, alle bisherigen Regeln gelten weiterhin – außer dass die Briten Sitz und Stimme im Europäischen Rat verlieren und in der EU nichts mehr zu sagen haben.
Dafür beginnt jetzt die eigentliche Arbeit: Bisher ging es nur um die Austrittsmodalitäten, ab dem 1. Februar aber müssen sämtliche Beziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich neu geordnet werden. Das betrifft die Zusammenarbeit auf allen Gebieten, in denen dies bisher mehr oder weniger reibungslos verlief: Europol, die europäische Forschungsförderung oder den Studentenaustausch. Was dabei bisher erreicht wurde, war nur der leichteste Teil der gesamten Übung. Nun aber beginnt der wirklich schwierige Teil der ganzen Prozedur.
Die Zeit drängt
Boris Johnson und seine Gefolgschaft glauben, auch diesmal mit Clownerie und grenzenloser Chuzpe durchkommen zu können. Da könnten sie sich allerdings gewaltig täuschen. Denn Johnson hat im vergangenen Herbst seine neue Variante des Austrittsabkommens in Brüssel nur deshalb bekommen, weil er der EU viel weiter entgegengekommen ist als seine glücklose Vorgängerin Theresa May. Und weil er sein Einknicken, trotz des Protests der nordirischen Unionisten, im ganzen Land als Erfolg verkaufen konnte.
Die EU hat mitgespielt, solange es noch eine kleine Hoffnung gab, den Brexit abwenden zu können. Diese Hoffnung ist nun begraben, von jetzt an wird mit härteren Bandagen gekämpft – aber auch nicht mit allzu harten. Denn Ende 2020 könnte Großbritannien immer noch ohne ein Abkommen austreten. Ein No-Deal ist nach wie vor möglich – und den möchte in Brüssel weiterhin niemand.
Erschwerend kommt hinzu, dass der Zeitplan für die Verhandlungen mehr als ambitioniert ist. Das zeigt sich besonders deutlich beim geplanten neuen Handelsvertrag zwischen London und Brüssel. Dieser wird um einiges komplexer ausfallen müssen als die Handelsverträge, die die EU mit Kanada, mit Japan, mit den Mercosur-Staaten und einigen anderen Ländern gerade verhandelt hat oder noch verhandelt. Sieben Jahre hat es allein gedauert, mit der kanadischen Regierung CETA zu beraten – und das war schon außergewöhnlich kurz. Doch keines dieser Abkommen war auch nur annähernd so komplex wie jenes, das die EU und Großbritannien jetzt verhandeln müssen. Wenn beide Seiten sich auf ein reines Rahmenabkommen, mithin einen Katalog von frommen Wünschen und wohlklingenden Absichtserklärungen beschränken, würden die Verhandlungen danach endlos weitergehen. Gerade Konfliktbereiche wie Landwirtschaft, Fischerei oder Finanzdienstleistungen können die Verhandler also weder aufschieben noch ausklammern.
Zunächst einmal müssen sich die in der EU verbleibenden 27 Mitgliedsstaaten auf eine gemeinsame Linie einigen, bevor die bewährte Truppe mit Michel Barnier als Chefunterhändler loslegen kann. Vor März werden die eigentlichen Verhandlungen daher nicht beginnen. Am Ende muss noch eine Ratifizierungsrunde durch die Parlamente aller 28 beteiligten Staaten und das Europaparlament folgen. Es ist also mehr als naiv zu glauben, man habe für diese Verhandlungen elf Monate Zeit. Daher bereitet sich die EU schon in aller Gemütsruhe auf den nächsten Aufschub vor: die Verlängerung der Übergangsfrist. Je länger diese dauert, desto besser für die EU-Finanzen, da London bis zum Ende dieser Frist weiter seine Beiträge an die EU abführen muss. Und soll Großbritannien nicht ohne Handelsabkommen ausscheiden, wird Johnson die EU spätestens im Herbst 2020 um eine Fristverlängerung bitten müssen.
Johnson in der Zwickmühle
Ein solcher Schritt könnte ihm aber noch gewaltige Probleme bereiten. Denn schon in ihrem Wahlprogramm hatten die Tories vollmundig angekündigt, einen neuen Handelsvertrag mit der EU unter Dach und Fach zu bringen – und zwar bis Ende dieses Jahres. Eine Verlängerung der Übergangsfrist werde es auf keinen Fall geben. Boris Johnson hat genau dieses Versprechen in Rechtsform gegossen, es steht nun als besondere Klausel im Gesetz zum EU-Austritt, das Unter- und Oberhaus beschlossen haben. Seitdem liegt die Latte noch ein wenig höher: Um eine Fristverlängerung beantragen zu können, müsste Johnson sein eigenes Austrittsgesetz im britischen Parlament revidieren lassen. Das werden ihm seine Gefolgsleute nicht ohne weiteres erlauben. Die Brexit-Hardliner wetzen schon die Messer: Auf keinen Fall wollen sie sich auf ein Handelsabkommen mit der EU einlassen, das gleiche Bedingungen auf beiden Seiten des Ärmelkanals garantiert. Vielmehr wollen sie an ihrer Vision eines „Singapur an der Themse“ – eines deregulierten Niedrigsteuerlandes – festhalten, und sei es nur als Drohung gegenüber Brüssel.
Doch die EU wird unter keinen Umständen einem Abkommen zustimmen, das eine Dumpingkonkurrenz vor der eigenen Haustür schafft. Daher hat sich Johnson selbst die Hände gebunden. Er hat sich von den wütenden Europafeinden in seiner Umgebung eine harte Deadline aufzwingen lassen – und eine Verhandlungslinie, die für die EU von vornherein unannehmbar ist. Also bliebe nur der No-Deal, der Austritt mit vollem Risiko, ohne einen neuen Handelsvertrag und ohne all die Verträge, die darüber hinaus notwendig sind, um die zukünftigen Beziehungen zwischen den Briten und ihren kontinentalen Nachbarn zu regeln. Selbst dann wäre der Austrittsvertrag immer noch in Kraft: Die vereinbarte Zollgrenze zwischen Nordirland und dem Rest des Königreichs beispielsweise bliebe weiterhin bestehen.
Johnson könnte den No-Deal oder einen demütigenden erneuten Verlängerungsantrag nur vermeiden, wenn er bereit wäre, der EU in allem nachzugeben. Das Vereinigte Königreich bekäme dann einen ähnlichen Status wie Norwegen. London und Brüssel würden sich auf Freihandel unter der Voraussetzung gleicher oder doch sehr ähnlicher Regularien auf beiden Seiten einigen. Die EU wäre bereit, auf Zölle und Quoten zu verzichten, wenn die Briten ihrerseits die gleichen Regularien und Standards in Sachen Verbraucher-, Umwelt- und Arbeitsschutz akzeptieren. Das aber wollen die Hardliner um keinen Preis. Johnson muss also entweder die Verhandlungen mit der EU scheitern lassen, und zwar von Anfang an, oder er muss den Konflikt mit den harten Brexiteers durchstehen.
Gegner eines harten Brexits wiederum hoffen, dass Johnson schon bald in seiner Lieblingsdisziplin glänzen wird, nämlich als glatter Wendehals. Mit seiner komfortablen Parlamentsmehrheit kann er es sich eigentlich leisten, nicht mehr über jedes Stöckchen zu hüpfen, das ihm die Hardliner hinhalten. Er könnte der EU Konzessionen machen, um die Verhandlungen zu beschleunigen. Aber will man sich darauf verlassen, dass Johnson zum Jahresende 2020 abermals den Sprung in den Abgrund des No-Deal vermeiden wird, auch bei Strafe des erneuten Gesichtsverlusts?
Der Traum vom Handelsimperium
Johnson schielt derweil über den Atlantik. Sein großer Freund Donald Trump soll ihm aus der Patsche helfen, selbst wenn Großbritannien bis zum Ende der Übergangsfrist kein neues Handelsabkommen mit einem anderen Staat außerhalb der EU abschließen darf. Aber auch danach wird Trump den Briten nichts schenken, ein möglicher Deal soll vor allem den USA nützen.
Seit Jahr und Tag warnen britische Experten davor, was die Trumpisten gerne hätten: Carte blanche für US-Konzerne, um die verbliebenen Reste des öffentlichen Sektors auf den britischen Inseln zu zerlegen und zu privatisieren. Den Stolz des Landes, den nationalen Gesundheitsdienst NHS, haben amerikanische Investoren schon länger im Visier. Aus diesem „sozialistischen“ Experiment eines steuerfinanzierten, staatlich organisierten und kontrollierten Gesundheitssystems für alle wollen die hektisch nach profitablen Anlagen suchenden Großinvestoren auf beiden Seiten des Atlantiks schon lange ein durch und durch privatkapitalistisch organisiertes Gesundheitswesen nach US-Vorbild machen. Zwar haben die Tories im Wahlkampf versprochen, den notorisch unterfinanzierten NHS wieder mit einigen Milliarden Pfund zusätzlich pro Jahr aufzupäppeln. Aber reichen wird das nicht, um den durch jahrelange Sparpolitik ausgezehrten Gesundheitsdienst wieder einigermaßen effizient zu machen und beispielsweise die monatelangen Wartezeiten für Arztbesuche und Operationen deutlich zu reduzieren. Damit aber haben die Tory-Ideologen ein starkes Argument in der Hinterhand, um dem Volk eine scheibchenweise Privatisierung des NHS schmackhaft zu machen.
Sie wiegen sich auch in dem Glauben, das britische Handelsimperium irgendwie wiederbeleben zu können. Den Handel mit der EU könne man leicht ersetzen, die Commonwealth-Länder stünden schon Schlange für neue Abkommen. Die sehen das allerdings ganz anders. Selbst wenn alle vormaligen britischen Kolonien auf Londons Avancen eingehen sollten – was Indien etwa schon vehement abgelehnt hat –, könnte das nicht die Verluste wettmachen, die die Handelsnation Großbritannien im Fall eines No-Deals erleiden würde. An Industrie- und Agrarprodukten haben die Briten der Welt wenig zu bieten, was die EU-Länder nicht besser und billiger anbieten könnten. Und Dienstleistungen, von denen die britische Wirtschaft zu 80 Prozent lebt, brauchen vielleicht Australien und Kanada, die übrigen Commonwealth-Länder eher nicht.
Die EU ist schwer zu ersetzen
Für Großbritannien war und ist die EU hingegen der wichtigste Handelspartner. Gut die Hälfte der britischen Im- und Exporte entfallen auf deren Mitgliedsländer, allein gut 40 Prozent auf die westeuropäischen Nachbarn Deutschland, Niederlande, Frankreich, Irland, Belgien, Spanien und Italien. Nur 15 Prozent ihres Außenhandels wickeln die Briten mit den USA ab, nur sechs Prozent mit China und weniger als zehn Prozent mit allen Commonwealth-Ländern zusammen. Für ausländische Konzerne – wie beispielsweise die japanischen und koreanischen Autobauer, die im Vereinigten Königreich produzieren – bildete das Land stets in erster Linie das Tor zu Europa. Schließt sich dieses Tor, werden sie abwandern. Sie tun es bereits und sind dabei, sich für alle Fälle mindestens ein zweites oder drittes Standbein auf dem Kontinent aufzubauen. Auch der britische Anteil an der europäischen Flugzeugindustrie, insbesondere am Airbus-Konsortium, steht mit dem Brexit vollständig in Frage. Dass die entsprechenden Produktions- und Wertschöpfungsketten so weiterlaufen wie bisher, ist höchst unwahrscheinlich, zumal die britischen Zulieferer leicht ersetzbar sind.
Die Verluste eines No-Deal Brexit würden selbst nach vorsichtigen Schätzungen gut acht Prozent der heutigen britischen Wirtschaftsleistung betragen und jeden britischen Haushalt durchschnittlich mehr als 2500 Pfund pro Jahr kosten. Am härtesten wird der Einbruch – der selbst bei einem geregelten Brexit droht – die heute schon verarmten ehemaligen Industrieregionen im Norden Englands treffen, also ausgerechnet jene Wähler aus der englischen Arbeiterschaft, die Johnson gerade zum Sieg verholfen haben. Johnson und seine Regierung werden sich somit im November entscheiden müssen: Wollen sie den No-Deal riskieren oder wollen sie mit der EU weiterverhandeln? Fest steht schon jetzt: Brüssel sitzt dabei am längeren Hebel.
Die Briten werden zudem gut 60 Handelsverträge mit Ländern in aller Welt, von denen sie als Teil der EU bis jetzt noch profitieren, nach Ablauf der Übergangsfrist ganz neu verhandeln müssen. Keines dieser Länder wird sich aber auf Verhandlungen mit London einlassen, solange die künftigen Handelsbeziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich ungeklärt sind. Und auch Donald Trump wird seinem Freund Boris nichts schenken. Für Johnson wiederum wäre es fatal, vor aller Augen von Washington über den Tisch gezogen zu werden, was ihm bei einem Deal mit den von Trump geführten USA aber blühen wird. Denn auch die Vereinigten Staaten sitzen am längeren Hebel – und auf „besondere Beziehungen“ zu Großbritannien geben Trump und seine Gefolgsleute gar nichts.
Schon jetzt ist daher absehbar: Ein neues Freihandelsabkommen mit Großbritannien werden die Europäer bis zum Ende dieses Jahres nicht vollständig aushandeln können, das hat Philip Hogan, der Handelskommissar der Europäischen Union Mitte Januar noch einmal bestätigt. Im Januar 2021 dürften die Briten daher immer noch im EU-Binnenmarkt sein und in Brüssel verhandeln. Der Brexit-Ärger bleibt uns also noch lange erhalten. Für die Briten aber fängt er jetzt erst richtig an.