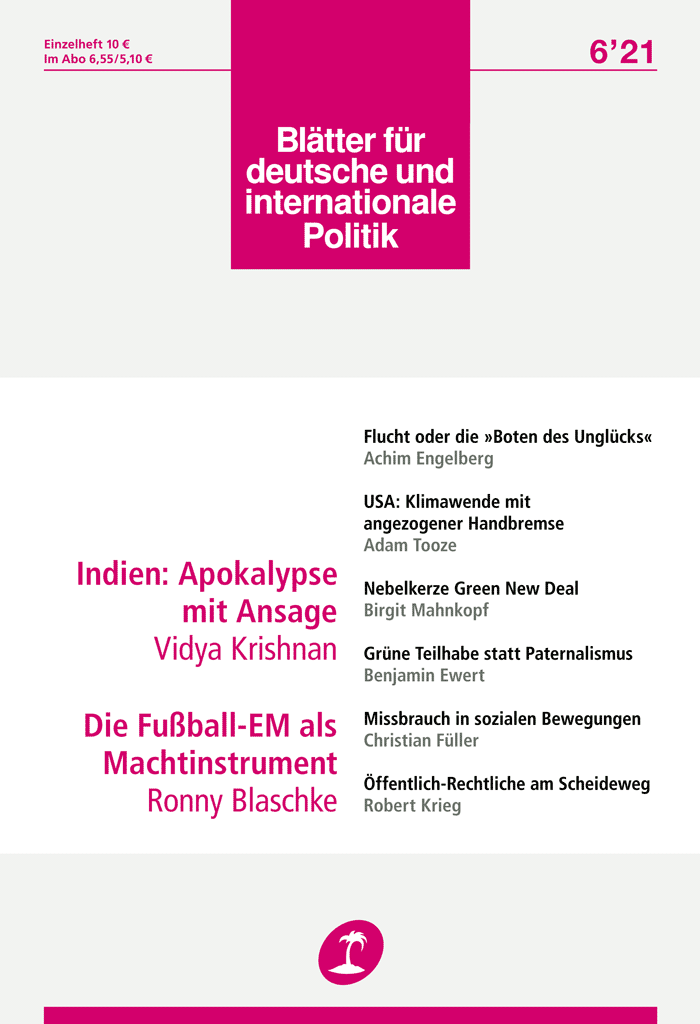Bild: Die Kandidatin Ana Llao gibt in Temuco (Chile) ihre Stimme bei der Wahl eines neuen Verfassungskonvents ab, 16. Mai 2021 (IMAGO / Aton Chile)
Inmitten der Pandemie haben die Chilen*innen Geschichte geschrieben: Mitte Mai wählten sie die Mitglieder eines Verfassungskonvents, der nun innerhalb eines Jahres einen neuen Gesellschaftsvertrag ausarbeiten soll. Dieser wird die noch aus Zeiten der Militärdiktatur unter Augusto Pinochet stammende alte Verfassung ersetzen. Damit hat sich eine zentrale Forderung der Proteste erfüllt, die das Land seit Oktober 2019 unter dem Motto Chile despertó (Chile ist aufgewacht) in Aufruhr versetzten und sein politisches System in eine tiefe Krise stürzten.
Diese Krise hat sich im Zuge der Coronapandemie noch einmal drastisch verschärft. Laut aktuellen Umfragen sind heute 75 Prozent der Chilen*innen sehr unzufrieden mit dem Funktionieren der Demokratie und ihren Institutionen. Über 90 Prozent sagen, dass die Politik nur Gesetze zum Wohle der mächtigen Wirtschaftselite macht. Und nur zwei Prozent geben an, dass eine Partei ihre Interessen vertritt. Das sind besorgniserregende Zahlen für eine repräsentative Demokratie.
Die Distanz zwischen den Chilen*innen und ihrem Staat ist seit Beginn der Proteste aufgrund der anhaltenden Polizeigewalt gegenüber Demonstrierenden sogar noch größer geworden. Erst vor kurzem haben mehrere nationale und internationale NGOs den rechtskonservativen Präsidenten Sebastián Piñera vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag angezeigt. Ihm werden Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen, da er die exzessive Gewalt von Polizei und Militär gegen seine Bürger*innen nicht gestoppt und Empfehlungen der Vereinten Nationen nicht umgesetzt hat.
Dabei waren die Zustimmungswerte des Präsidenten erst Anfang März wieder leicht gestiegen, von sechs Prozent ein Jahr zuvor auf immerhin 14 bis 20 Prozent. Denn noch vor wenigen Wochen wurde Chile als Impfchampion gefeiert – weit mehr als die Hälfte der chilenischen Bevölkerung ist bereits geimpft. Doch die Ernüchterung folgte auf den Fuß: Mittlerweile ist die Zahl der Neuansteckungen so hoch wie nie zuvor und seit Januar hat sich die Zahl der Coronatoten verdoppelt. Über 95 Prozent der Intensivbetten sind landesweit belegt, die Krankenhäuser überfüllt. Vor allem jüngere, nicht geimpfte Menschen sind heute betroffen. Damit befindet sich der Andenstaat in einem äußerst kritischen Moment der Pandemie.
Zu ihrer Eindämmung hat die Regierung erneut einen strengen Lockdown verhängt. Niemand darf die Wohnung verlassen, nur zweimal wöchentlich kann man mit polizeilicher Genehmigung Lebensmittel einkaufen gehen. Viele Menschen, die gehofft hatten, der schnelle Impferfolg würde Chile vor einer neuen Welle verschonen, sind nun fassungslos und enttäuscht. Die Stimmung ist daher angespannt: Schon im vergangenen Jahr mussten die Chilen*innen eine der längsten Ausgangssperren der Welt aushalten. Doch während Kindergärten und Schulen seit Ausbruch der Pandemie beinahe durchgehend geschlossen sind, lockerte die Regierung Ende 2020 die Corona-Beschränkungen vor allem für die Wirtschaft viel zu schnell, wodurch sie die zweite Welle maßgeblich mit auslöste.
Zwar hat sich die Regierung, anders als in den meisten anderen lateinamerikanischen Ländern, frühzeitig und erfolgreich um die Beschaffung von Impfstoff gekümmert. Doch seit Beginn der Impfkampagne konzentriert sich in Chile alles auf das Impfen, während andere wichtige Maßnahmen wie Testen, Kontaktnachverfolgung und Prävention vernachlässigt wurden – trotz der wiederholten Kritik des chilenischen Ärzteverbands. Auch deswegen steigen jetzt die Infektionszahlen.
Verschärfend kommt hinzu, dass der in Chile zu 90 Prozent eingesetzte chinesische Impfstoff Coronavac laut einer Studie der Universidad de Chile und der chinesischen Seuchenschutzbehörde nur rund 50 Prozent Schutz vor einer Ansteckung mit dem Virus bietet. Auch wird vermutet, dass die brasilianische Mutation in Chile mittlerweile stark verbreitet ist. Diese gilt als deutlich ansteckender und möglicherweise auch gefährlicher als die Ursprungsversion und treibt daher die Inzidenzwerte in die Höhe.
Zudem scheint dem Land der „Impferfolg“ in gewisser Weise zum Verhängnis zu werden. Denn dank des Rankings als „Impfweltmeister“ und des Diskurses der Regierung von der baldigen Herdenimmunität haben sich die Chilen*innen in den südamerikanischen Sommermonaten von Januar bis März nicht mehr so gut geschützt wie zuvor: weniger Maskengebrauch, mehr Partys am Strand, Pauschalurlaub in Brasilien, volle Shoppingcenter und Märkte, große Silvesterfeiern. Die Sorglosigkeit der Geimpften – die sich weiterhin mit dem Virus anstecken und es übertragen können – hat sich für die restliche Gesellschaft als Gefahr entpuppt.
Das größte Problem ist allerdings, dass sich viele Menschen schlicht nicht an die Hygiene- und Lockdown-Regeln halten können. Denn das neoliberale Chile ist sozial zutiefst gespalten. Viele Menschen haben kein Geld für Masken, leben in sehr beengten Verhältnissen und können bei Erkrankungen keinen Abstand halten. Das gilt besonders für den großen Anteil der informell Beschäftigten: Fast jede*r zweite Chilen*in arbeitet ohne Arbeitsvertrag und damit ohne jegliche Rechte – als Hausangestellte, Bauarbeiter, Kellnerin, Straßenverkäufer, Essenslieferantin oder Taxifahrer. Umfragen zufolge verheimlichen über 30 Prozent der Corona-Erkrankten ihre Ansteckung und gehen weiter arbeiten, um über die Runden zu kommen. Sie können es sich schlichtweg nicht leisten, sich und andere vor Corona zu schützen.
Existenzängste in der Pandemie
Verschärfend kommt hinzu, dass ein Großteil der Chilen*innen seit Ausbruch der Pandemie massive Einkommensverluste verzeichnet. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung gibt in Umfragen an, dass sie ihre Ausgaben bis zum Monatsende nicht decken kann. Drei Viertel der chilenischen Haushalte sind mittlerweile verschuldet – der höchste Wert in ganz Lateinamerika. Und nur noch knapp ein Drittel kann sich drei Mahlzeiten am Tag leisten. Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit und Armut breiten sich rasant aus. Allein in der Hauptstadt Santiago ist die Zahl der in Elendsvierteln oder auf der Straße Lebenden im vergangenen Jahr um 235 Prozent gestiegen; viele Menschen müssen die Essensausgaben der solidarisch organisierten Suppenküchen nutzen. Die Angst vor dem sozialen Abstieg ist angesichts dessen allgegenwärtig, und mit jedem weiteren Tag im Lockdown bangen mehr Menschen um ihre Existenz.[1]
Doch während die unter Druck geratene Mittelschicht nur in sehr geringem Umfang Arbeitslosengeld und Sozialhilfe erhält, ist die extreme Ungleichheit, gegen die die Menschen bereits vor Corona landesweit protestiert hatten, im Zuge der Pandemie noch gewachsen. Laut „Forbes“ konnten die reichsten acht chilenischen Familien ihr Vermögen seit deren Beginn um 73 Prozent steigern.[2] Dabei verfügte das eine Prozent der Wohlhabendsten bereits vor der Pandemie über 27 Prozent des landesweiten Vermögens.[3]
Der Markt wird gerettet, die Menschen vergessen – lautet entsprechend die Kritik der Sozialverbände und Gewerkschaften an der Politik der Regierung. Anders als in Deutschland ist der Staat selbst in Pandemiezeiten kein Garant für soziale Sicherheit, eher im Gegenteil. Bislang nämlich bezahlen die Arbeitnehmer*innen die Krise weitgehend aus der eigenen Tasche; seit 2020 durften sie mehrmals zehn Prozent ihrer Einlagen bei der Rentenkasse abheben, wenn sie Geld benötigten. Bislang wurden auf diese Weise insgesamt rund 18 Mrd. US-Dollar an Renteneinlagen abgehoben, während der Staat nur rund 5 Mrd. Dollar für soziale Hilfsprogramme ausgegeben hat. Mehr als drei der 17 Millionen Chilen*innen haben sich sogar bereits ihre gesamten Rentenersparnisse auszahlen lassen und verfügen künftig über keinerlei Pensionsansprüche mehr.[4] Damit dürfte sich das schon jetzt große Problem der Altersarmut in Zukunft noch weiter verstärken. Der chilenische Gewerkschaftsdachverband CUT fordert deshalb schnelle finanzielle Unterstützung für die verarmenden Chilen*innen. Und auch der Ruf nach einem universellen Grundeinkommen bis zum Ende der Pandemie wird immer lauter.
Die Wut über die massive soziale Ungerechtigkeit hatte sich indes bereits ab Herbst 2019 in den größten Protesten seit dem Ende der Diktatur entladen. „Der Neoliberalismus wurde in Chile geboren und muss auch hier sterben“, lautete einer der Slogans der Proteste. Seit Pinochet mit Hilfe der Chicago Boys ein neoliberales Wirtschaftssystem etablierte, gilt der Andenstaat als eines der „wirtschaftsfreundlichsten“ Länder der Welt. Als sein politisches Erbe hat Pinochet 1990 eine Verfassung hinterlassen, die die Rolle des Staates auf ein Minimum reduziert. Wichtige Bereiche der sozialen Sicherheit – Bildung, Gesundheit, Rente – sind seitdem beinahe vollständig privatisiert, darunter auch lebensnotwendige Dinge wie die Wasserversorgung.
Die Folgen werden zu Coronazeiten gerade in der Gesundheitsversorgung sichtbar. Wer keine gedeckte Kreditkarte besitzt, hat schlechte Aussichten: Die Covid-19-Sterblichkeit ist in den einkommensschwachen Vierteln der Hauptstadt um ein Vielfaches höher als in den wohlhabenden Gegenden. Nur etwa 15 Prozent der Menschen können sich eine Behandlung in den gut ausgestatten privaten Krankenhäusern leisten. Die restlichen 85 Prozent müssen im Ernstfall mit einem der völlig unterfinanzierten öffentlichen Krankenhäuser vorliebnehmen.[5] Schon vor Corona starben jährlich mehr als 15 000 Menschen, weil die Wartezeiten dort extrem lang sind; eine Krebstherapie kann die ganze Familie in den finanziellen Ruin treiben.[6]
Trotz mehrfacher Verfassungsreformen in den letzten 31 Jahren blieben die neoliberalen und konservativen Prinzipien Pinochets in der Magna Carta verankert. Die hier festgeschriebene untergeordnete, subsidiäre Rolle des Staates hat bis heute zur Folge, dass keine Regierung seit dem Ende der Diktatur einen Sozialstaat aufbauen konnte – denn eine Politik, die öffentliche Güter stärkt, ist meist nicht verfassungskonform.
Eine Konvent der Hoffnung
Das könnte sich nach der jüngsten Wahl des Verfassungskonvents nun ändern. Eindeutiger Verlierer dabei sind die Verteidiger des Status quo: Das rechtskonservative Regierungsbündnis von Piñera kam nur auf rund 20 Prozent der 155 Sitze, womit es über keine Vetomacht verfügt. Die großen Gewinner sind dagegen neue linke Kräfte: In erster Linie haben sich parteiunabhängige Kandidat*innen, die die Anliegen der Protestbewegung vertreten, durchgesetzt. Auch feministische Organisationen gewannen zahlreiche Sitze. Gemeinsam mit den traditionellen sozialdemokratischen und neuen linken Parteien stellen sie mehr als zwei Drittel der Versammlungsmitglieder. Progressive, reformorientierte Kräfte haben somit theoretisch viel Gestaltungsmacht. In der Praxis stehen sie nun vor der Herausforderung, über Partei- und Organisationsgrenzen und persönliche Streitigkeiten hinweg eine breite Allianz zu schmieden. Gelingt dies, bestünde tatsächlich die Chance, die Forderung der Protestbewegung nach einer stärkeren Rolle des Staates durchzusetzen.
Doch ob die neue Verfassung am Ende wirklich den Weg in eine Gesellschaft zu ebnen vermag, die über ein funktionierendes öffentliches Gesundheitswesen, ein gerechtes Bildungssystem, menschenwürdige Löhne und Renten sowie ein nachhaltigeres Wirtschaftsmodell verfügt, ist mehr als ungewiss. Denn neben enormen Chancen birgt der Verfassungsprozess auch erhebliche Risiken – etwa eine verschärfte gesellschaftliche Polarisierung und steigende Frustration, falls die Protestbewegung ihre Forderungen nicht ausreichend berücksichtigt sieht. Neben dem weit verbreiteten Wunsch nach sozialen Grundrechten zählen dazu auch die Forderungen der indigenen Völker nach mehr Anerkennung und Inklusion oder die der Umweltbewegung nach einer „ökologischen Verfassung“, die die Rohstoffausbeutung auf Kosten der Natur nicht länger zulässt. Daneben könnte allerdings auch die, teils durch die Pandemie bedingte, niedrige Wahlbeteiligung von nur 40 Prozent der Legitimität der Versammlung schaden. Vor allem aber verfügt der Neoliberalismus in Chile nach wie vor über einflussreiche Fürsprecher. Die wirtschaftliche Elite des Landes hat in den letzten Jahrzehnten sehr von dem bisherigen neo-extraktivistischen Wirtschaftsmodell, der kaum regulierten Rohstoffausbeutung und den Privatisierungen profitiert und ist nicht gewillt, ihre Privilegien einfach aufzugeben. Daher ist kräftiger Gegenwind gegen jegliche Art von progressiven Veränderungen zu erwarten.
Sollte es trotz des Widerstandes gelingen, ein gemeinwohlorientierteres Grundgesetz zu ratifizieren, wird dieses jedoch frühestens in etwa fünf Jahren Wirkung zeigen. So lange dauert es laut Verfassungsexpert*innen, bis neue politische Rahmenbedingungen und anschließend verabschiedete Gesetze umfassende Veränderungen ermöglichen. Chiles abstürzende Mittelschicht aber kann darauf nicht warten, sie benötigt schneller Hilfe.
Fest steht: Auf der Versammlung lasten enorme Hoffnungen; ein Scheitern könnte Chile in eine neue Krise stürzen. Dennoch kann der Prozess schon jetzt als historisch bezeichnet werden. Denn zum ersten Mal seit 1812 formulieren demokratisch gewählte Vertreter*innen und nicht Militärs die Verfassung. Und Chile ist das erste Land weltweit, in dem eine verfassungsgebende Versammlung paritätisch besetzt ist und Frauen und Männer gleichermaßen beteiligt werden. Das wiederum sind gute Nachrichten für die Demokratie.
[1] Vgl. Barómetro del Trabajo Abril 2021, www.fielchile.cl.
[2] Los súper ricos chilenos: Forbes pone en ranking al Presidente Piñera y destaca aumento de fortuna en plena pandemia, www.elmostrador.cl, 6.4.2021.
[3] Cepal confirma alta concentración de la riqueza en Chile: el 1% más acaudalado es dueño del 26,5% del PIB, www.latercera.com, 15.1.2019.
[4] Vgl. El tercer retiro dejaría a cinco millones de personas sin ahorros para pensión, www.pauta.cl, 20.4.2021.
[5] Vgl. Angaben der öffentlichen Krankenkasse FONASA, www.fonasa.cl.
[6] Vgl. Bericht des chilenischen Gesundheitsministeriums, www.minsal.cl, 15.1.2018.