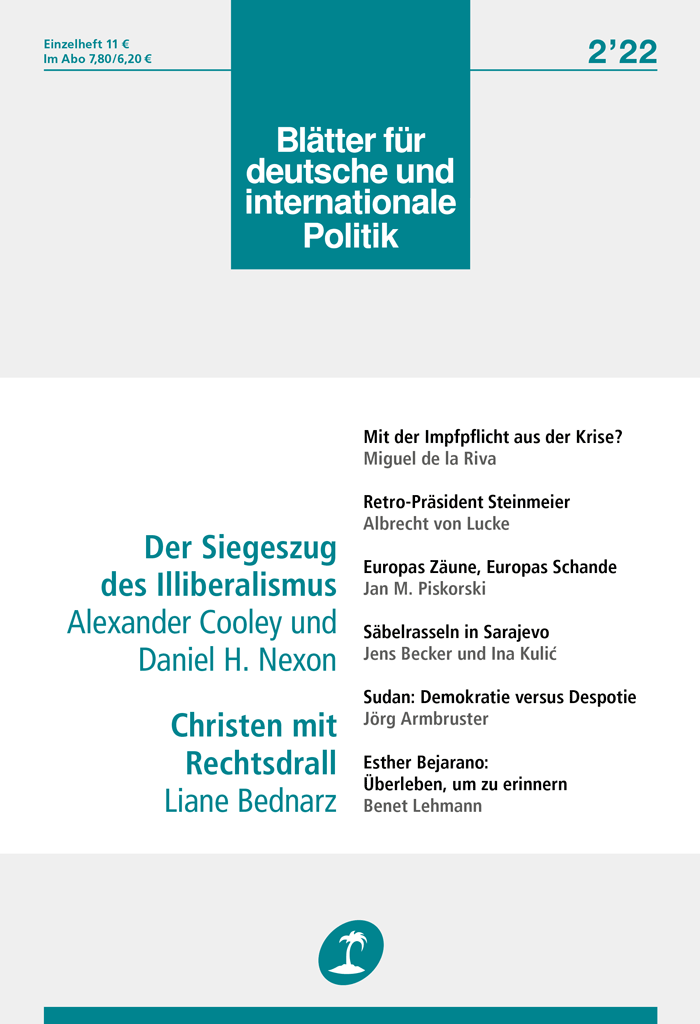Das polnisch-belarussische Flüchtlingsdrama und die Macht der Bilder

Bild: Ein Banner mit dem Bild eines Flüchtlingskindes neben einem polnischen Grenzmarkierungspfahl bei Michalowo (Polen), 23.10.2021 (IMAGO / NurPhoto)
Es gibt Fotos, die den Lauf der Welt verändert haben. Meist handelt es sich dabei um ältere Aufnahmen aus der Zeit vor der allgemeinen digitalen Bilderflut. Die Bilder von im Feuer schmorenden Kindern aus Ludlow in Colorado waren verschwommen, man hatte sie aus einiger Entfernung aufgenommen. Der Besitzer des dortigen Bergwerkes hatte 1914 die Nationalgarde angeheuert, damit sie die Baracken der Bergarbeiter, die angemessene Löhne forderten, in Brand steckte. Es waren diese Bilder, die in der öffentlichen Meinung zu einem Umdenken beim Thema Streik führten. Der Kohletrust errang einen Pyrrhussieg, denn der Kongress in Washington sah sich gezwungen, für den Schutz der Arbeiter einzutreten.
Aufnahmen, die Kinder als Opfer zeigen, wirken von jeher auf die kollektive Vorstellungskraft, insbesondere wenn sie nicht durch krude Brutalität vor den Kopf stoßen. Ein Übermaß an Gewalt – so der amerikanische Dokumentarfilmer und Kriegsberichterstatter Tim Hetherington in einem Interview mit dem wunderbaren Titel „Der Krieg der guten Menschen“ – schockiert nämlich und bringt nicht zum Nachdenken, sondern resultiert in Gleichgültigkeit. Man vergleiche Hetheringtons Dokumentarfilm „Restrepo“ über den Krieg in Afghanistan mit der allzu platten Darstellung des Krieges in Wojtek Smarzowskis Film „Sommer 1943 – Das Ende der Unschuld“.