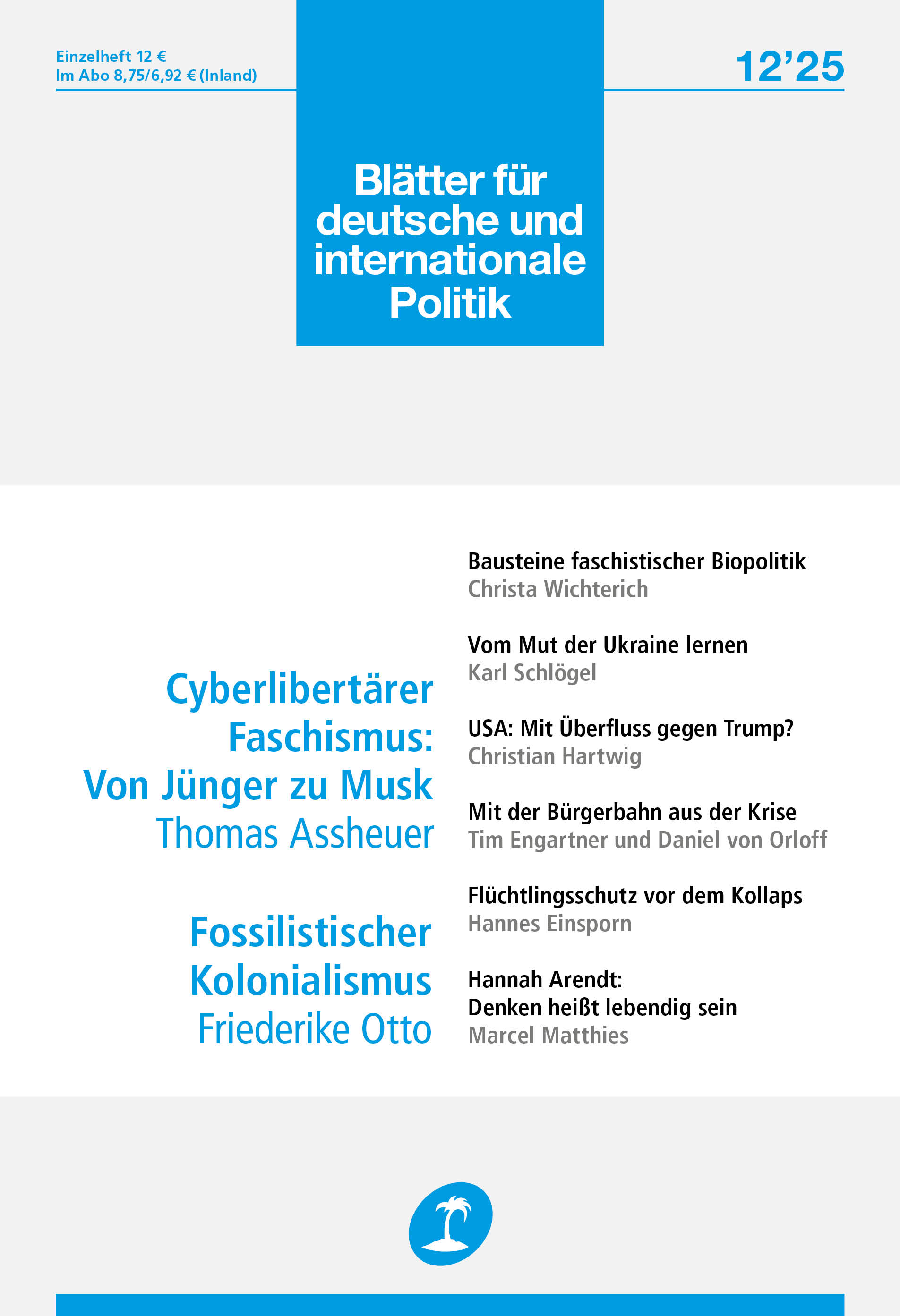Bild: Eine Frau vor dem Registrierungszentrum des UNHCR-Flüchtlingscamps in Adre, Tschad, 1.9.2024 (IMAGO / Martin Bertrand)
Am 14. Dezember jährt sich die Gründung des UNHCR, des Amts des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen, zum 75. Mal. Nach dem Zweiten Weltkrieg sollte die Behörde Lösungen finden für die Millionen Flüchtlinge in Europa. Es war auch die Erfahrung massiver Zurückweisung geflüchteter Jüdinnen und Juden durch viele Länder während des Nationalsozialismus und der gescheiterten Flüchtlingskonferenz von Évian 1938, die die internationale Staatengemeinschaft nach dem Holocaust dazu bewegte, 1950 das UNHCR zu gründen. 1951 folgte die Genfer Flüchtlingskonvention, mit der man sich auf allgemeinverbindliche Regeln zum Umgang mit Flüchtlingen einigte. Die Konvention regelt unter anderem, wer Flüchtling ist und dass eine Person nicht zurückgewiesen werden darf, wenn ihr damit Gefahr für Freiheit und Leben droht. Mit anderen Worten: Es entstand eine kollektive Verantwortlichkeit, die nicht erst verhandelt werden musste. Heute haben 149 Staaten die Flüchtlingskonvention und/oder das Protokoll von 1967 unterzeichnet, das die zeitliche und geografische Begrenzung der Konvention auf Ereignisse vor 1951 und nur europäische Flüchtlinge auflöste. Die Arbeit des UNHCR wurde damit global. Mit nationalen Gesetzgebungen, wie in den USA 1980 oder in Deutschland 1982, wurde die Flüchtlingskonvention in nationalem Recht verankert.
Doch dessen ungeachtet steckt der internationale Flüchtlingsschutz heute in einer tiefen Krise. Die Zahl der Flüchtlinge hat in den vergangenen Jahren den höchsten Stand seit dem Zweiten Weltkrieg erreicht. 2024 zählte der UNHCR weltweit 42,7 Millionen Flüchtlinge, zwei Drittel davon leben in Ländern mit niedrigem oder mittlerem Einkommen. Zugleich wird die Möglichkeit, Asyl zu beantragen, weltweit immer weiter eingeschränkt oder gar unmöglich gemacht. Einige Regierungen plädieren bereits für eine Überarbeitung der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951. Unterdessen treffen die drastischen Kürzungen der US-Auslandshilfen sowie von anderen großen internationalen Geldgebern, darunter Deutschland, Flüchtlinge und die Flüchtlinge aufnehmenden Staaten im Globalen Süden hart. Selbst der UNHCR ist von den Kürzungen betroffen: Mehr als ein Viertel der Mitarbeitenden mussten entlassen werden. Das Jahresbudget der Organisation wird sich in diesem Jahr voraussichtlich auf 3,9 Mrd. US-Dollar belaufen. Zuletzt waren die Einnahmen des UNHCR vor zehn Jahren, 2015, unter die Marke von vier Mrd. Dollar gefallen, allerdings war damals die Zahl der Flüchtlinge weltweit nur halb so hoch. Sogar die Existenz des UNHCR als eigenständige Institution steht 75 Jahre nach seiner Gründung auf der Kippe. Laut dem Reformplan des UN-Generalsekretariats „UN80“ könnte die Organisation mit anderen Teilen der UN zusammengelegt werden.[1]
Ein System ungleicher Verantwortung
Wo aber liegen die Ursachen für die aktuelle Krise? Ein Teil der Erklärung liegt in den Unzulänglichkeiten des Systems selbst. Es ist schlicht nicht verlässlich geregelt, wie die internationale Verantwortung für den Schutz von Flüchtlingen geteilt wird. Die Genfer Flüchtlingskonvention betont in ihrer Präambel lediglich, dass es „internationaler Zusammenarbeit“ bedarf, denn sonst würden sich für einige Länder, die Asylrecht gewähren, „nicht zumutbare schwere Belastungen“ ergeben. Wenn wir auf die gewaltsamen Konflikte und Kriege in Afghanistan, Somalia oder auf dem Balkan, auf Bürgerkriege in Zentralamerika, den Genozid in Ruanda, den zweiten Irakkrieg oder den Syrienkrieg blicken, die ab den 1980er Jahren zu millionenfacher Flucht geführt haben, dann fällt auf, dass die Menschen vor allem in die direkten Nachbarländer fliehen. Die Verantwortung für Flüchtlinge wird somit zuvorderst durch die Nähe eines Landes zu Kriegsschauplätzen und Krisen bestimmt. Doch in direkten Nachbarländern fehlt es oft an effektivem Schutz, einer grundlegenden Versorgung und an langfristigen Perspektiven für Flüchtlinge wie etwa den Zugang zum Arbeitsmarkt. In der Folge migrieren Flüchtlinge weiter. Flucht wird damit zur globalen Herausforderung.
Als in den 1980er Jahren in vielen westlichen Industrieländern die Zahl der Asylanträge von per Flugzeug eingereisten Personen anstieg, wurden Airlines alsbald in die Pflicht genommen, die Dokumente ihrer Passagiere vor der Beförderung verschärft zu prüfen. Ebenso in dieser Zeit entstand der Ansatz, Länder als „sichere Drittstaaten“ einzustufen, womit Asylsuchende wieder in die Länder zurückgeführt werden können, in denen sie zuerst Schutz gesucht hatten. In den 2000er Jahren intensivierten wohlhabende Länder auch die Zusammenarbeit mit Drittstaaten zur Grenzsicherung, die in Europa nach der sogenannten Flüchtlingskrise 2015/16 stark ausgeweitet wurde. Das Resultat: Die Staaten des Globalen Nordens – allen voran die USA und die EU –verschieben ihre Grenzen weit in andere Länder hinein. Die Grenzen werden, wie es der Soziologe Steffen Mau treffend bezeichnet hat, zu „Sortiermaschinen“, die unter anderem die Mobilität von Schutzsuchenden einschränken.[2] Dass das Menschen nicht davon abhält, Schutz und Perspektiven in wohlhabenderen Ländern zu suchen, zeigt die nach wie vor große Zahl jener Menschen, die gefährliche und oft auch tödliche Wege nutzen, um an ihr Ziel zu gelangen, etwa die Fluchtrouten über das Mittelmeer nach Europa. Sichere und reguläre Wege für Flüchtlinge sind hingegen äußerst rar. In der Regel beschränken sich diese auf kleine Programme weniger Staaten, von denen nur eine eng ausgewählte Gruppe von Flüchtlingen profitiert.
Grob gesprochen, funktionierte der internationale Flüchtlingsschutz lange nach einem einfachen Schema: Eine kleine Zahl von Ländern nimmt die Mehrzahl der Flüchtlinge auf, wenige Länder des Globalen Nordens finanzieren das Gros des internationalen Hilfesystems, einen Apparat aus internationalen Organisationen, darunter der UNHCR, nationalen Einrichtungen in den Aufnahmeländern sowie Organisationen der internationalen und nationalen Zivilgesellschaft. Doch die finanzielle Unterstützung für die Hauptaufnahmeländer und die dortigen Flüchtlinge – folgt man den Zahlen der Vereinten Nationen – ist mittlerweile überall unzureichend und unzuverlässig. Auch die Finanzierung des UNHCR ist prekär und abhängig von einigen wenigen Ländern. Die Organisation finanziert sich ausschließlich aus freiwilligen Beiträgen, die zu einem beträchtlichen Teil aus den USA sowie der EU und ihren Mitgliedstaaten stammen. Andere Länder, die mittlerweile die wirtschaftliche Kraft dazu hätten, tragen hingegen nicht mehr als eine symbolische Unterstützung bei. Chinas Beitrag für den UNHCR etwa belief sich 2025 auf gut vier Mio. US-Dollar, während die USA knapp 812 Mio. Dollar und die EU knapp 348 Mio. Dollar zahlten.[3]
Weltweiter Angriff auf das Asylrecht
Der UNHCR unternahm bereits mehrere Anläufe, um diese Situation zu verändern. Die Idee: Die Genfer Flüchtlingskonvention soll um Regeln und Mechanismen ergänzt werden, damit die Teilung der internationalen Verantwortung endlich verlässlicher funktioniert. Der frühere Hochkommissar für Flüchtlinge, Ruud Lubbers, versuchte es 2004 mit der „Convention Plus Initiative“, sein Nachfolger, António Guterres, mit der „Solutions Alliance“. Schließlich folgte der bislang erfolgreichste Versuch: die New York Declaration on Refugees and Migrants, eine politische Erklärung, die 2016 von 193 Mitgliedstaaten unterzeichnet wurde, und der daraus folgende, 2018 von der UN-Generalversammlung verabschiedete Globale Pakt für Flüchtlinge. Aber auch dieser, unter dem aktuellen Hohen Flüchtlingskommissar Filipo Grandi entstandene Pakt, steht auf tönernen Füßen. Er basiert darauf, dass wohlhabendere Länder die ärmeren Hauptaufnahmeländer unterstützen – mit Geld, aber auch, indem sie Möglichkeiten für Flüchtlinge fördern, auf sicherem und regulärem Weg Schutz zu suchen. Der UNHCR, der zusammen mit einer wechselnden Gruppe von Staaten die Umsetzung des Pakts vorantreiben soll, mobilisiert die Unterstützung mittels regelmäßiger Konferenzen. Doch die Hilfsbereitschaft hält sich in Grenzen: Von den 1326 angekündigten staatlichen Beiträgen seit 2019 – darunter fällt finanzielle Unterstützung, Hilfe bei der Integration von Flüchtlingen oder deren Umsiedlung durch spezielle Programme – wurden bisher nur rund ein Viertel tatsächlich erbracht.[4] Dieses fragile und unzulängliche, aber bislang alternativlose System wird gegenwärtig von drei Entwicklungen in eine tiefe Krise gestürzt.
Erstens missachten Regierungen weltweit zunehmend und offen das Recht auf Asyl und Nichtzurückweisung, bevor entschieden ist, ob den Asylsuchenden bei einer Rückkehr in ihre Heimatländer Gefahr für Freiheit und Leben droht. Unter Trump werden Asylsuchende nach unzureichenden Verfahren abgeschoben und keine neuen Asylgesuche an US-Grenzen mehr zugelassen. In Ländern wie Finnland oder Polen werden Asylsuchende gar per parlamentarischem Beschluss an Landesgrenzen abgewiesen. Dänemark, Italien, Österreich und Polen forderten im Verbund mit fünf weiteren europäischen Regierungen in diesem Jahr eine Debatte über die Auslegung der Europäischen Menschenrechtskonvention durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Der EGMR müsse den Nationalstaaten mehr Spielraum bei der Abweisung und Ausweisung von Migranten lassen. Der Gerichtshof in Straßburg hatte Italien zuvor mehrfach wegen seiner Behandlung von Mi-
granten verurteilt und Dänemark dazu aufgefordert, seine Regelungen zur Familienzusammenführung zu ändern. Fest steht: Die Rechtsprechung des EGMR spielt eine entscheidende Rolle dabei, wie das Prinzip der Nichtzurückweisung in Europa auszulegen ist. Stellen die dem Gerichtshof unterworfenen Staaten die Urteile aus Straßburg infrage, ist das ein politischer Angriff auf das europäische Menschenrechtssystem. Auch die USA wollen das System des internationalen Flüchtlingsschutzes reformieren. Bei der diesjährigen Generalversammlung der Vereinten Nationen brachten sie eine Reform der Flüchtlingskonvention ins Spiel, der zufolge Asyl nur im ersten Land gewährt werden soll, das Schutzsuchende betreten. Das heißt in den überwiegenden Fällen: das direkte Nachbarland. Im September äußerte sich die stellvertretende Hochkommissarin für Flüchtlinge, Ruvendrini Menikdiwela, zu diesen Entwicklungen: „Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass die Institution des Asyls weltweit jetzt stärker bedroht ist als jemals zuvor.“[5]
Zweitens verändert sich insgesamt das Engagement von Staaten zur Wahrung der Prinzipien des internationalen Flüchtlingsschutzes, etwa indem sie Rechtsverletzungen anderer Staaten im bilateralen Gespräch oder in der Öffentlichkeit anmahnen. Weltweit sinkt das Vertrauen in multilaterale Institutionen und die bisher allgemeinverbindlich geltenden Regeln der internationalen Zusammenarbeit. Das trifft auch den UNHCR und die Regeln des internationalen Flüchtlingsschutzes. Ein Regelwerk aber, dessen Missachtung keine Folgen nach sich zieht – weder durch erzwungene Einhaltung noch durch positive Anreize –, führt langfristig zu dessen Kollaps.
Drittens bricht die internationale Unterstützung von Hauptaufnahmeländern und Flüchtlingen weg, die die Aufnahmebereitschaft in ärmeren Ländern fördern sollen. Die USA waren nicht nur der wichtigste Geldgeber vieler dieser Länder, sondern boten auch vielfältige andere Formen der Unterstützung an – von diplomatischem Engagement in Fluchtsituationen bis hin zum weltweit größten Umsiedlungsprogramm, das zehntausenden Flüchtlingen Hoffnung auf ein sicheres Leben gab. Der abrupte Wegfall dieses US-Engagements unter Trump ist das prägnanteste Beispiel der weltweiten Abkehr vom Flüchtlingsschutz. Der Apparat der internationalen Solidarität, durch den etwa Bildungsangebote in Flüchtlingscamps organisiert oder besonders bedürftige Flüchtlinge unterstützt werden, erlebt einen dramatischen finanziellen Einbruch. Das zeigt exemplarisch das Beispiel Sudan, wo sich mit fast 3,4 Millionen registrierten Flüchtlingen und Asylsuchenden eine der größten Flüchtlingskrisen weltweit abspielt. Es fehlen fast 80 Prozent der Mittel, die gebraucht würden, um die in die Nachbarstaaten geflüchteten Sudanesinnen und Sudanesen zu versorgen.[6] Allein das Nachbarland Tschad, eines der ärmsten Länder der Welt, hat innerhalb kurzer Zeit rund eine Million Flüchtlinge aus dem Sudan aufgenommen. Zugleich sind die globalen Zusagen für die Umsiedlungen von Flüchtlingen in andere Länder 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 85 Prozent eingebrochen.[7] Die Folgen des Wegbrechens der Hilfe sind gravierend: So beobachtet der UNHCR, dass Flüchtlingsfamilien ihre Kinder vermehrt zur Arbeit anstatt in die Schule schicken, Mädchen verheiraten oder ihre ohnehin schon kargen Mahlzeiten weiter reduzieren.
Wege aus der Krise
Wenn zum Jahreswechsel ein Nachfolger für den aktuellen Hochkommissar für Flüchtlinge Filippo Grandi sein Amt antreten wird, steht dieser vor enormen Herausforderungen. Wie aber kann der UNHCR in der aktuellen Situation auf ein funktionierendes System des internationalen Flüchtlingsschutzes hinwirken? Die Rufe nach Reformen ertönen am lautesten aus wohlhabenden Ländern. Doch viele der angestrebten Veränderungen wie die Rückführung von Asylsuchenden in Drittstaaten mit Hilfe zwischenstaatlicher Abkommen haben zur Folge, dass die Verantwortung für die Millionen Flüchtlinge weltweit weiter auf ärmere Länder ausgelagert wird.[8] Der UNHCR sollte angesichts dieser Entwicklungen auf die Etablierung von Standards für Migrationsabkommen hinwirken, die sowohl die Belange aller Staaten und die Rechte der Flüchtlinge wahren als auch die Interessen der ärmeren Staaten stärker berücksichtigen. Um zwischen den Interessen wohlhabender und ärmerer Länder zu vermitteln und die internationale Zusammenarbeit zu erhalten, sollte der UNHCR auch seine Arbeit und Ansätze weiterentwickeln. Zentrales Anliegen vieler Staaten und großer Teile ihrer Bevölkerungen ist es, mehr Kontrolle darüber zu erlangen, wer auf welchem Wege in ihr Staatsgebiet einreist. Da hilft es nicht, darauf hinzuweisen, dass „irreguläre Migration“ – unter die auch Asylsuchende fallen – nur einen Bruchteil des weltweiten Migrationsgeschehens ausmacht. In der Europäischen Union etwa waren es 2023 nur rund zehn Prozent der Zugewanderten, die irregulär einreisten, auch um Schutz zu suchen.[9] Sichere und legale Möglichkeiten der Migration für Flüchtlinge würden dagegen Asylsysteme entlasten und die Chance bieten, die gewünschte Kontrolle zu erlangen. Dazu gehören Programme der humanitären Aufnahme für besonders schutzbedürftige Menschen, aber auch verbesserte Möglichkeiten der Arbeitsmigration für Flüchtlinge. Für viele Flüchtlinge, die ohne Perspektive in den oft armen Hauptaufnahmeländern leben, würde sich durch verbesserte Chancen auf Erwerbsmigration eine geordnete Alternative zur irregulären Migration eröffnen. Zugleich sind viele wohlhabende Länder auf Migration angewiesen, um angesichts alternder Gesellschaften ihre Wirtschaften, aber langfristig auch ihre Systeme der Daseinsvorsorge und Sozialsysteme zu sichern. Flüchtlingen mehr Möglichkeiten der Mobilität zu eröffnen, ist aber auch aus einem anderen Grund vorausschauend: Fast 75 Prozent der Flüchtlinge weltweit leben in jenen Ländern, die am stärksten von den Folgen des Klimawandels betroffen sind – und werden früher oder später dort noch weniger Möglichkeiten zum Leben und Überleben vorfinden.[10] Ihnen bereits jetzt Perspektiven zu eröffnen, kann helfen, Migration vorausschauend und geordnet zu gestalten.
Darüber hinaus ist ein funktionierendes System der internationalen Solidarität mit Flüchtlingen und ihren Hauptaufnahmeländern in den ärmeren Teilen der Welt schlicht aus humanitären Gründen unabdingbar. Doch aller Voraussicht nach werden der UNHCR und das System des internationalen Flüchtlingsschutzes auf längere Sicht mit deutlich weniger Geld auskommen müssen. Daher ist der Handlungsdruck groß, Hilfe effizienter zu organisieren. Ansätze, wie das gelingen kann, sind lange bekannt – es gilt, sie auch umzusetzen, nicht zuletzt durch den UNHCR. Dazu zählt etwa, Hilfe stärker zu bündeln und sie lokalen Organisationen bereitzustellen, anstatt sie an ein komplexes Netz aus Organisationen der Vereinten Nationen und internationalen Nichtregierungsorganisationen zu verteilen.[11] Ein Netz lokaler Initiativen und Organisationen, oft von Flüchtlingen selbst geführt, organisiert bereits heute in vielen Fluchtsituationen effektive Hilfe, etwa im Sudan.[12] Diese bleiben aber weitgehend von internationaler Finanzierung ausgeschlossen, auch wenn sie teilweise effektiver arbeiten als andere Organisationen.[13] Gelingt es nicht, den internationalen Flüchtlingsschutz effizienter zu organisieren und die Verantwortung besser zu verteilen, droht der seidene Faden, an dem er hängt, zu reißen – und damit ein erheblicher zivilisatorischer Rückschritt. Die katastrophalen Folgen kollektiver Verantwortungslosigkeit müssen mit aller Kraft vermieden werden, gerade in Zeiten des weltweiten Aufschwungs von Autokraten und eines Höchststands an gewaltsamen Konflikten.
[1] Vgl. auch Jan Eijking, 80 Jahre UNO: Auf dem Weg in die Bedeutungslosigkeit?, in: „Blätter“, 10/2025, S. 79-84.
[2] Steffen Mau, Sortiermaschinen: Die Neuerfindung der Grenze im 21. Jahrhundert, München 2021.
[3] Global Funding Overview for 2025, unhcr.org, 30.9.2025.
[4] Pledges & Contributions, globalcompactrefugees.org, 7.6.2024.
[5] UNHCR official warns that the 1951 refugee convention is increasingly under threat, apnews.com, 17.9.2025.
[6] Operational Data Portal, data.unhcr.org, 30.10.2025.
[7] Deputy High Commissioner Kelly Clements’ speech at the Consultations on Resettlement and Complementary Pathways, 25.6.2025.
[8] Vgl. auch Bernd Kasparek und Vassilis Tsianos, Zehn Jahre „Wir schaffen das!“. Wie Europa das Asylrecht abwickelt, in: „Blätter“, 8/2025, S. 111-116.
[9] Statistics on migration to Europe, commission.europe.eu, 28.5.2025.
[10] Klimakrise als Fluchtgrund, unoflüchtlingshilfe.de, 9.7.2025.
[11] A Humanitarian Reset Has Started: It’s Time to Act on What We Already Know, ggpi.net, 25.6.2025.
[12] Vgl. Andrea Böhm, Sudan: Mit Basisdemokratie gegen den Horror des Krieges, in: „Blätter“, 11/2025, S. 13-16.
[13] The failure to fund refugee-led organisations: why the current system is not working, and the potential for change, odi.org, 3.11.2023.