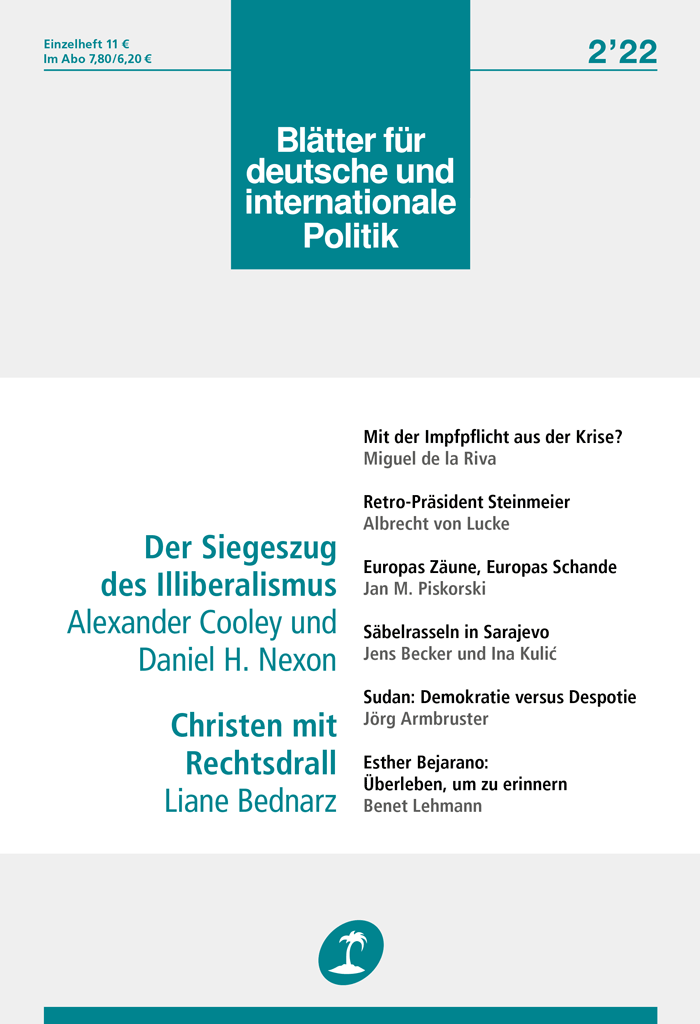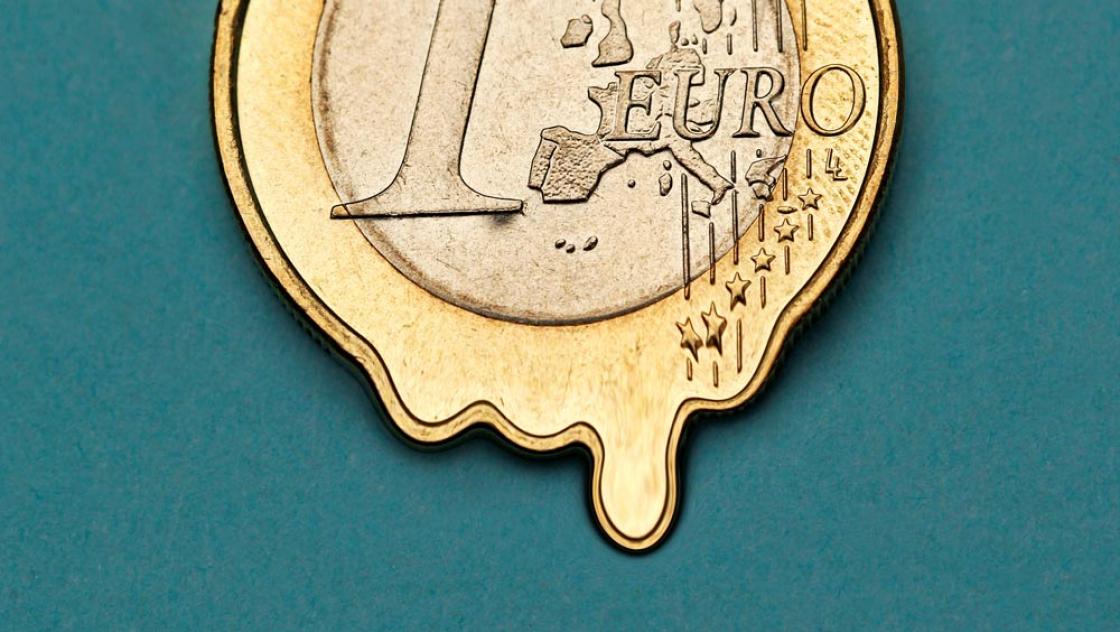
Bild: PolaRocket / photocase.de
Als hätte die Ampel-Koalition nicht schon genug neue Probleme, ist sie zusätzlich noch mit einer altbekannten Thematik konfrontiert, der Inflation. Nach einer Inflationsrate nahe null im Corona-Abschwungjahr 2020 stieg die Geldentwertung 2021 von Monat zu Monat bis auf über fünf Prozent zum Ende des Jahres. Letztmals wurde ein derartiger Kaufkraftverlust vor 30 Jahren, im Juni 1992, erreicht.
Die Konsequenz: Inflationsängste machen sich breit, die zusätzlich mit der absurden historischen Anspielung auf die Hyperinflation von 1923 geschürt werden. Dabei dominierte noch vor kurzem die Sorge vor Deflation, die durch sinkende Preise auf breiter Front die Unternehmenserlöse verringert und somit die Gesamtwirtschaft schrumpfen lässt. Die Notenbank stand daher vor der Aufgabe, den zu niedrigen Preisindex in Richtung der Zielinflationsrate von zwei Prozent nach oben zu bewegen.
Angesichts der überraschend hohen Inflationsraten ist die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank in die Kritik geraten. Wurde bislang die Zielinflationsrate von zwei Prozent zwecks Vermeidung einer Deflation als Schmiermittel zugunsten der wirtschaftlichen Dynamik gerechtfertigt, löst der aktuelle Inflationsanstieg nun die Forderung nach dem Tritt auf die geldpolitische Bremse aus.
Dabei sind es vor allem die Marktfundamentalisten, die attackieren. Jedenfalls ruft das jahrelange Regime der Niedrigzinsen den eigentlich tot geglaubten Monetarismus auf den Plan.