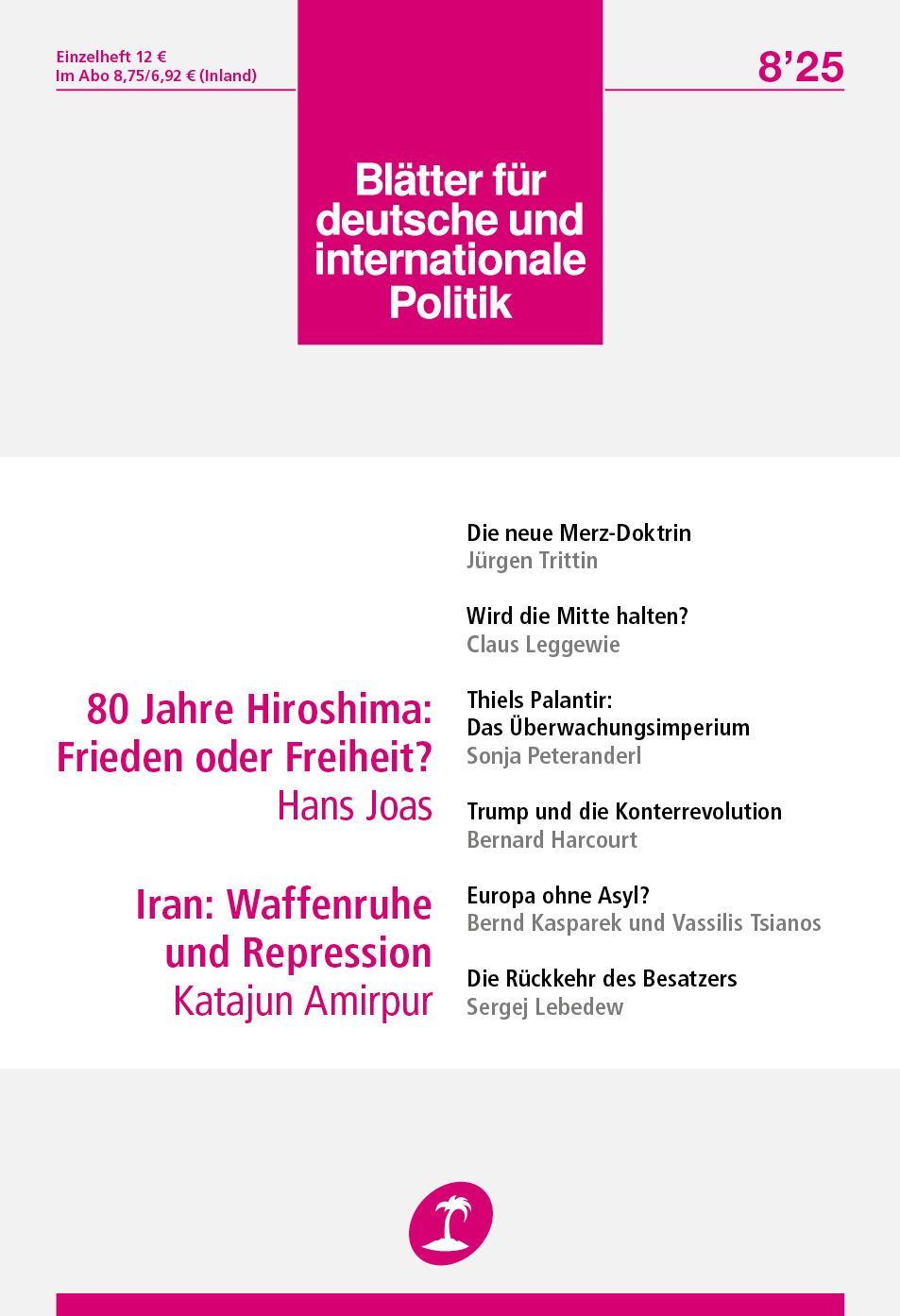Bild: Ein Arbeiter im Rheinmetall-Werk, 6.6.2023 (IMAGO / sepp spiegl)
Die neue schwarz-rote Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD, die sich selbstbewusst als „Koalition der Möglichmacher“ inszeniert, ist in ihren ersten drei Monaten nach der Wahl von Friedrich Merz am 6. Mai mit einem schwerwiegenden Widerspruch konfrontiert: Der Wille zur politischen Gestaltung kollidiert mit ideologisch geprägten Prioritäten, insbesondere im Spannungsfeld von Sicherheits-, Wirtschafts-, Klima- und Sozialpolitik. Während die globale Mehrfachkrise – ökologisch, ökonomisch, geopolitisch – entschiedenes Handeln verlangt, wirkt die neue Regierung orientierungslos zwischen Investitionsdruck und Finanzierungsvorbehalt, zwischen Verteidigungsimperativ und sozial-ökologischer Verantwortung.
Wie „sozial“ die propagierte wirtschaftsliberale Wende hin zu einer sozialen Marktwirtschaft à la Ludwig Erhard gestaltet wird, ist höchst fragwürdig, wenn für die Verantwortlichen weiter gilt: Mehr Markt, weniger Staat. Während die Wirtschaftspolitik unter globalem Druck steht, driftet sie von der vormals angestrebten sozial-ökologischen Transformation zur neoliberalen Reaktion. Auch wenn die Prognosen der Institute nach langer Zeit wieder positiver ausfallen: Die wirtschaftspolitische Lage Deutschlands ist und bleibt hoch angespannt. Nach Jahren des Strukturwandels und pandemiebedingter Belastungen ist die Bundesrepublik in eine Phase der hartnäckigen Stagnation geraten. Der wirtschaftliche Abschwung – befeuert durch globale Unsicherheiten, hohe Energiepreise, nachlassende Export-dynamik und protektionistische Trends – wird von der neuen Bundesregierung jedoch nicht langfristig und nachhaltig, sondern vor allem durch kurzfristige steuerpolitische Entlastungen bekämpft.
Das zeigt vor allem der neue Haushalt für das Jahr 2025, gewissermaßen das Rechnungsbuch der Nation auf der Ebene des Bundes, das über die wichtigen Einnahme- und Ausgabenschwerpunkte Auskunft gibt: Der Finanzierungsvorbehalt wird künftig das wichtigste Instrument des neuen Finanzministers Lars Klingbeil sein, wie bereits der Verzicht auf die eigentlich versprochene Abschaffung der Stromsteuer für alle gezeigt hat. Dabei sollen, noch abgesegnet vom Vorgängerbundestag, bis 2029 über 850 Mrd. Euro an Krediten aufgenommen werden. Maßgeblich dafür sind das beschlossene Sondervermögen für „Infrastruktur und Klimaneutralität“ sowie die nach oben unbegrenzte Kreditfinanzierung für „Verteidigung, Zivilschutz und Nachrichtendienste“.
Folge dieser massiven Kreditaufnahme ist die Verdoppelung der Zinsausgaben auf 62 Mrd. Euro bis 2029. Der Bundesfinanzminister hält seine Schuldenpolitik dennoch für tragfähig. Denn die Regierung Merz/Klingbeil setzt voll auf die Stärkung der Wirtschaftskraft, aus der die Kredite künftig finanziert werden sollen – eine wegen der Steuersenkungen hoch gewagte Wette auf die Zukunft. Das Herzstück des neuen Sofortprogramms ist dabei eine Unternehmenssteuerreform, die auf Sonderabschreibungen und schrittweise Körperschaftsteuersenkungen von 15 auf 10 Prozent setzt. Hinzu kommt klassische Klientelpolitik zugunsten der Agrarwirtschaft durch wiedereingeführte Dieselsubventionen und der Gastronomie durch den neuen Mehrwertsteuersatz von 7 statt bisher 19 Prozent auf Speisen. Die Hoffnung dabei: Unternehmen sollen durch höhere Nettogewinne mehr investieren. Doch dieser wachstumsökonomische Reflex ignoriert nicht nur die strukturellen Ursachen der Investitionszurückhaltung, wie Fachkräftemangel und hohen bürokratischen Aufwand, sondern begrenzt den fiskalischen Spielraum langfristig – insbesondere für notwendige öffentliche Investitionen in Transformation, Bildung und Gesundheit. Obwohl die Legende vom selbstfinanzierenden Wachstum längst widerlegt wurde, setzt die Regierung hier auf die Trickle-Down-Logik (am Ende sickert angeblich immer etwas von oben nach unten zu den Bürgerinnen und Bürgern durch) – ohne Investitionsgarantie für die Unternehmen, aber mit hohem fiskalischen Risiko für die schwächsten unter ihnen und zudem auf Kosten von Klima- und Sozialpolitik. Das unausgereifte Konzept der Finanzspritze zeigt sich nämlich an den Firmen, die davon maßgeblich profitieren sollen: Dies sind in erster Linie Großunternehmen und Kapitalgesellschaften, die substanzielle Gewinne erzielen und dadurch überhaupt erst abschreibbare Investitionen tätigen können. Kleine und mittlere Unternehmen, insbesondere im Handwerk oder Einzelhandel, werden dagegen stark vernachlässigt.
Strukturbruch per Ausnahmeregel
Das rettende Instrument zur Haushaltssteuerung wurde mit einem verfassungsrechtlichen Kniff geschaffen: Die Schuldenbremse wurde in mehreren Punkten modifiziert, um zwei neue kreditfinanzierte Sondervermögen zu ermöglichen: 500 Mrd. Euro für Infrastrukturinvestitionen und Klimaneutralität, davon 100 Mrd. Euro an die Länder, und 100 Mrd. Euro für den Klima- und Transformationsfonds. Doch die Gefahr besteht, dass diese Mittel durch das Kriterium der „Zusätzlichkeit“ nicht zur Umsetzung bereits geplanter Maßnahmen genutzt werden können – ein strukturelles Paradox, welches vor allem in den Kommunen die bereits bestehende Krise weiter verschärfen könnte. Städte und Gemeinden können seit über 20 Jahren nicht einmal mehr die bestehende Infrastruktur erhalten, die zunehmend verfällt.[1] Durch das Zusätzlichkeitskriterium können Gelder aber nicht ohne Weiteres für die Projekte eingesetzt werden, die unter den höchsten Finanzierungsdefiziten leiden, nämlich bereits gebaute Schulen, Verkehrsin-frastruktur und etablierte Klimaschutzmaßnahmen. Institutionelle Schwächen wie Personalmangel und bürokratische Hürden bei Projektplanung, -genehmigung und -ausschreibung sind in den kommunalen Verwaltungen heute schon am gravierendsten und werden sich durch den zusätzlichen Bearbeitungsaufwand weiter vergrößern.[2]
Diesen Einschränkungen im Bereich der Strukturinvestitionen steht eine Entgrenzung der Verteidigungsausgaben gegenüber: Alle Aufwendungen über einem Prozent des BIP (derzeit rund 44 Mrd. Euro) sind nun von der Schuldenbremse ausgenommen. Dies eröffnet potenziell unbegrenzte Rüstungsausgaben über Kredite – und das ohne parlamentarische Kontrolle. Vor dieser „unkontrollierten Verschuldungsdynamik“[3] warnte der Bundesrechnungshof bereits und empfahl, den Richtwert stattdessen bei zwei Prozent anzusetzen. Eine undemokratische, kreditfinanzierte Verteidigungspolitik ohne Obergrenzen kann sich im schlimmsten Falle zu einer Aufrüstungsspirale auf Pump entwickeln – mit einer außenpolitischen Signalwirkung, die zukünftige Abrüstungsinitiativen massiv erschwert. Die Bundesregierung hat auf diese Weise eine fatale asymmetrische Priorisierung geschaffen: Sind bei Investitionen aus dem Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität“ tatsächlich positive Wachstumswirkungen zu erwarten, gilt dies nicht für die Rüstungsausgaben, da diese die ökonomische Produktivität eben gerade nicht steigern. Während aber gerade für die wichtigen Investitionen in Klima- und Sozialinfrastruktur restriktive Bedingungen gelten, ist die Finanzierung von Sicherheitsausgaben in weiten Teilen entgrenzt. Angesichts der maroden Bedingungen und massiven strukturellen Problemen im ökologischen und sozialen Bereich konterkariert diese Gewichtung das angebliche Bemühen um eine gerechtere und nachhaltigere Gesellschaft.
Besonders umstritten ist das von Bundeskanzler Friedrich Merz propagierte Ziel, mittelfristig fünf Prozent des BIP für „Sicherheit“ aufzuwenden. Unter diesen Begriff fallen neben klassischer Verteidigung auch Zivilschutz, Nachrichtendienste und Cybersicherheit. Diese politische Dehnbarkeit des Sicherheitsbegriffs ist höchst intransparent und wird sich noch intensivieren, wenn nicht klar definiert wird, was als Verteidigungsausgabe zählt. In der neuen Haushaltsplanung steigt die Kreditaufnahme im Verteidigungsbereich auf 158 Mrd. Euro bis 2029. Dadurch wird das neue Nato-Ziel mit 3,5 Prozent für reine Militärinvestitionen (bei zusätzlich 1,5 Prozent für Infrastruktur) bereits sechs Jahre früher als vereinbart erreicht.
Die Verankerung des Fünf-Prozent-Ziels bedeutet letztlich eine tektonische Verschiebung der Prioritäten im Bundeshaushalt, mit dramatischen Konsequenzen: Wenn die Kreditfinanzierung an Grenzen stößt, müssen andere Ausgabenbereiche – Bildung, Soziales, Umwelt – drastisch gekürzt oder die Steuerbasis erhöht werden. Letzteres wird von Schwarz-Rot bereits politisch ausgeschlossen, es bleibt also nur die Kürzung. Der aufgeladene Sicherheitsdiskurs verdrängt so zentrale Fragen des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der Generationengerechtigkeit. Er steht damit im Widerspruch zu den politischen Leitlinien der aktuellen Regierung und entwickelt sich zu einem politischen Hebel für Verschiebungen im Haushalt – auf Kosten der sozialen Gerechtigkeit.
Retrokurs bei Klima und Sozialem
Die Transformation zur klimaneutralen Wirtschaftsweise, einst Flaggschiffprojekt der Ampelkoalition unter Wirtschaftsminister Robert Habeck, droht ebenfalls unter der neuen Regierung zu versanden. Zwar bleiben die Mittel des Klima- und Transformationsfonds formal erhalten, doch ein Richtungswechsel ist offensichtlich.
So schlägt die Bundesministerin für Wirtschaft und Energie den Ausbau von Gaskraftwerken mit mindestens 20 Gigawatt Gesamtleistung bis 2030 vor – das entspricht 40 großen Kraftwerksblöcken. Statt Investitionen in erneuerbare Energien zu priorisieren, setzt Katherina Reiche auf CCS-Technologien (Abscheidung und Speicherung von CO2), deren Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit umstritten sind. Gleichzeitig bleiben vielversprechende nachhaltige Kernkonzepte wie Green Steel, Wasserstoff und energetische Sanierung in der Schwebe. In der Automobilpolitik gibt es derweil Bemühungen, das EU-weite Aus für Verbrennerautos hinauszuzögern – ein Rückschritt auf dem Weg zu einer dringend notwendigen Verkehrswende. Die ökologischen Leitplanken der Vorgängerregierung weichen so einem industrie- und wachstumsgetriebenen Rückgriff auf rein fossile Infrastrukturen.
Neben der ökologischen Transformation sind auch die sozialen Sicherungssysteme und die öffentliche Infrastruktur von der Umverteilung des Finanzspielraums betroffen. Die steuerpolitischen Maßnahmen wirken höchst selektiv: E-Auto-Bonus nur für Unternehmen, nicht aber für Privathaushalte. Die Erhöhung der Pendlerpauschale dient vor allem dem Autoverkehr und steht der Verkehrswende entgegen. Am schwersten aber wiegen die Steuerausfälle von bis zu 46 Mrd. Euro bis 2029, die vor allem die angeschlagenen Kommunen treffen. Diese werden so zu weiteren Kürzungen und der Erhebung höherer Abgaben gezwungen, was schließlich die Bürger und Bürgerinnen direkt betrifft. In Zeiten wachsender Kinder- und Altersarmut und steigender Verbraucherpreise riskiert die Regierung so eine Verschärfung der wirtschaftlichen Lage in den ohnehin am schlechtesten ausgestatteten Verwaltungseinheiten des Landes, nämlich bei den Kommunen.
Während also für Rüstung unbegrenzte Mittel zur Verfügung stehen, wird in den Bereichen Bildung, Pflege, Gesundheit und Soziales ein drastischer Sparkurs mit dem Dogma fiskalischer Unvermeidbarkeit gerechtfertigt. Besonders prekär: Notwendige Investitionen in Schulen, Krankenhäuser oder sozialen Wohnungsbau werden mit Verweis auf Haushaltszwänge aufgeschoben oder gestrichen. Dabei müssten gerade öffentliche Investitionen in Bildung, Gesundheit und Klimaschutz sofort angegangen werden – nicht zuletzt zur Stabilisierung der Binnenkonjunktur. Die bereits geplanten und genehmigten Projekte aus dem Sondervermögen „Infrastruktur“ böten hier einen Anknüpfungspunkt. Die Zusätzlichkeitsklausel darf daher hier nicht als Ausschlusskriterium gelten, sondern muss flexibel gehandhabt werden, damit wichtige bestehende Projekte weiter finanziert werden können.
Nicht zuletzt der aktuelle Hitze- und Katastrophen-Sommer zeigt: Der Umbauprozess im Sinne einer nachhaltigen Wirtschaft muss aufrechterhalten werden. Das schließt aber die von Schwarz-Rot forcierte Substitution von erneuerbaren Energien durch Gaskraftwerke aus. Innovative Projekte wie Wasserstoffwirtschaft, Green Steel, Mobilitätswende und energetische Gebäudesanierung müssen dagegen weiter gefördert werden, anstatt bloß auf Investitionen aus der Privatwirtschaft zu hoffen. Bestimmte energieintensive Branchen könnten dabei immer noch gezielt gefördert werden, sollte deren internationale Wettbewerbsfähigkeit gefährdet sein.
Die schwarz-rote Regierung agiert derzeit wirtschaftspolitisch mit einem rückwärtsgewandten Verständnis von Wachstum, das Investitionen primär über Steuerentlastungen stimulieren will, flankiert von Aufrüstung ohne fiskalische Begrenzung. Die angekündigte „Koalition der Möglichmacher“ erscheint damit mehr als ein Bündnis gegen ökologische Verantwortung und für sicherheitspolitische Überdehnung. Ihre kurzfristig angelegten Einzelmaßnahmen (Pendlerpauschale, Mütterrente, Agrardiesel-Subvention, Senkung der Gastro-Mehrwertsteuer) haben eine populistische Stoßrichtung, die sich der aktuellen gesellschaftlichen Polarisierung unterwirft, aber langfristig nicht funktionieren kann.
Was letztlich fehlt, ist eine integrierte Politik, die soziale Gerechtigkeit, ökologische Transformation und wirtschaftliche Erneuerung zusammendenkt. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt: Ohne den koordinierenden, fördernden Staat werden die notwendigen Umbauten weder realisierbar noch gesellschaftlich vermittelbar sein. Schwarz-Rot hat die Wahl: Steht die Koalition für eine ökologisch-solidarische Zukunftsgestaltung oder für die Fortsetzung des Krisenmanagements mit fossilem Rückgrat? Leider spricht viel für Letzteres.
[1] Carl-Friedrich Höck, Änderung der Schuldenbremse: Wie Kommunen den Gesetzentwurf bewerten, demo-online.de, 13.6.2025.
[2] André Berghegger, Kommunale Investitionskraft am Limit: DStGB fordert nachhaltige Finanzreform, dstgb.de, 22.5.2025.
[3] Bundesrechnungshof, Schuldenbremse: Umgehung gefährdet solide Staatsfinanzen, bundesrechnungshof.de, April 2024.