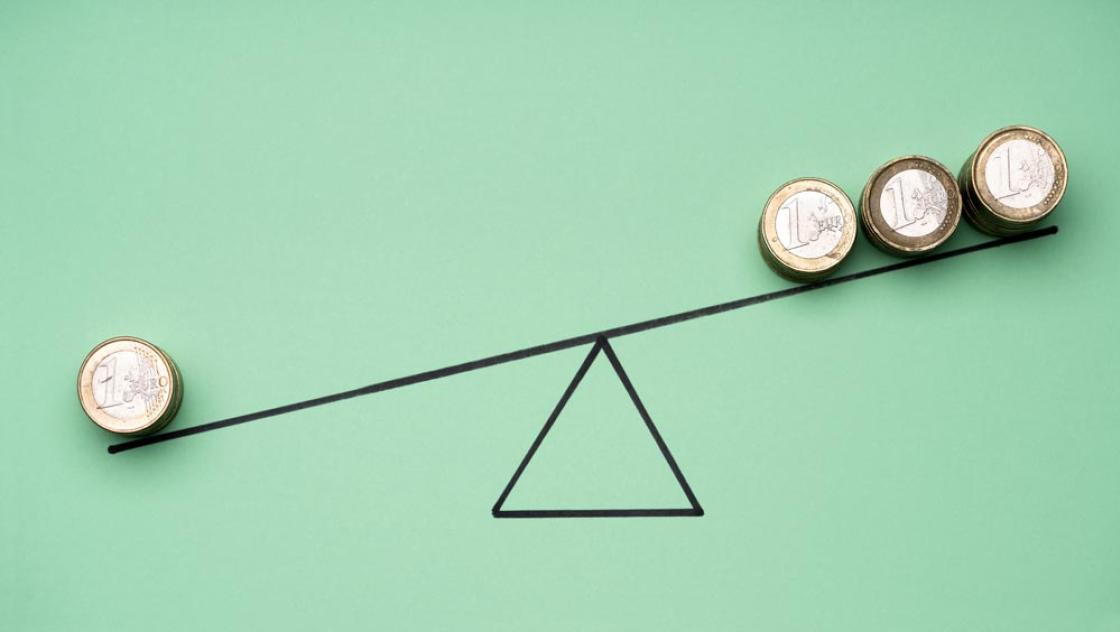
Bild: Symbolbild: Einkommens- und Ungleichverteilung (IMAGO / Panthermedia)
In der Juli-Ausgabe der „Blätter“ argumentierte der Wirtschaftswissenschaftler Frank Hoffer, die Rente könne durch Produktivitätswachstum und eine gerechtere Finanzierung gesichert werden. Eine Integration von allen Beschäftigten in eine allgemeine Rentenversicherung lehne er jedoch ab. Dem widerspricht der Gewerkschaftssekretär Maximilian Waclawczyk. Er kritisiert das vorherrschende Narrativ der „gestörten Generationengerechtigkeit“ und fordert eine solidarische Erwerbstätigenversicherung für alle sowie eine gerechte Besteuerung von Kapitaleinkünften, hohen Vermögen und Erbschaften, um die Rente zukunftsfest zu machen.
Die Menschen müssten mehr und länger arbeiten, das Rentenniveau müsse gesenkt, „hohe“ Renten gekürzt und allgemein mehr privat vorgesorgt werden – die Liste der Vorschläge für eine Reform des deutschen Rentensystems ist lang. Immer wieder und mit großer Hartnäckigkeit wird dabei das Narrativ von der gestörten Generationengerechtigkeit bemüht, auch in der aktuellen Debatte über die Stabilisierung des Rentenniveaus.
Den argumentativen Bezugspunkt im momentanen Gerechtigkeits- und Sozialstaatsdiskurs bildet die durch den demografischen Wandel drohende Überforderung der Jungen: „Die Babyboomer müssen ihren Teil dazu beitragen, dass die Sozialversicherungssysteme nicht kollabieren“, forderte jüngst Monika Schnitzer.[1]
Dabei besteht für demografischen Alarmismus kein Anlass.









