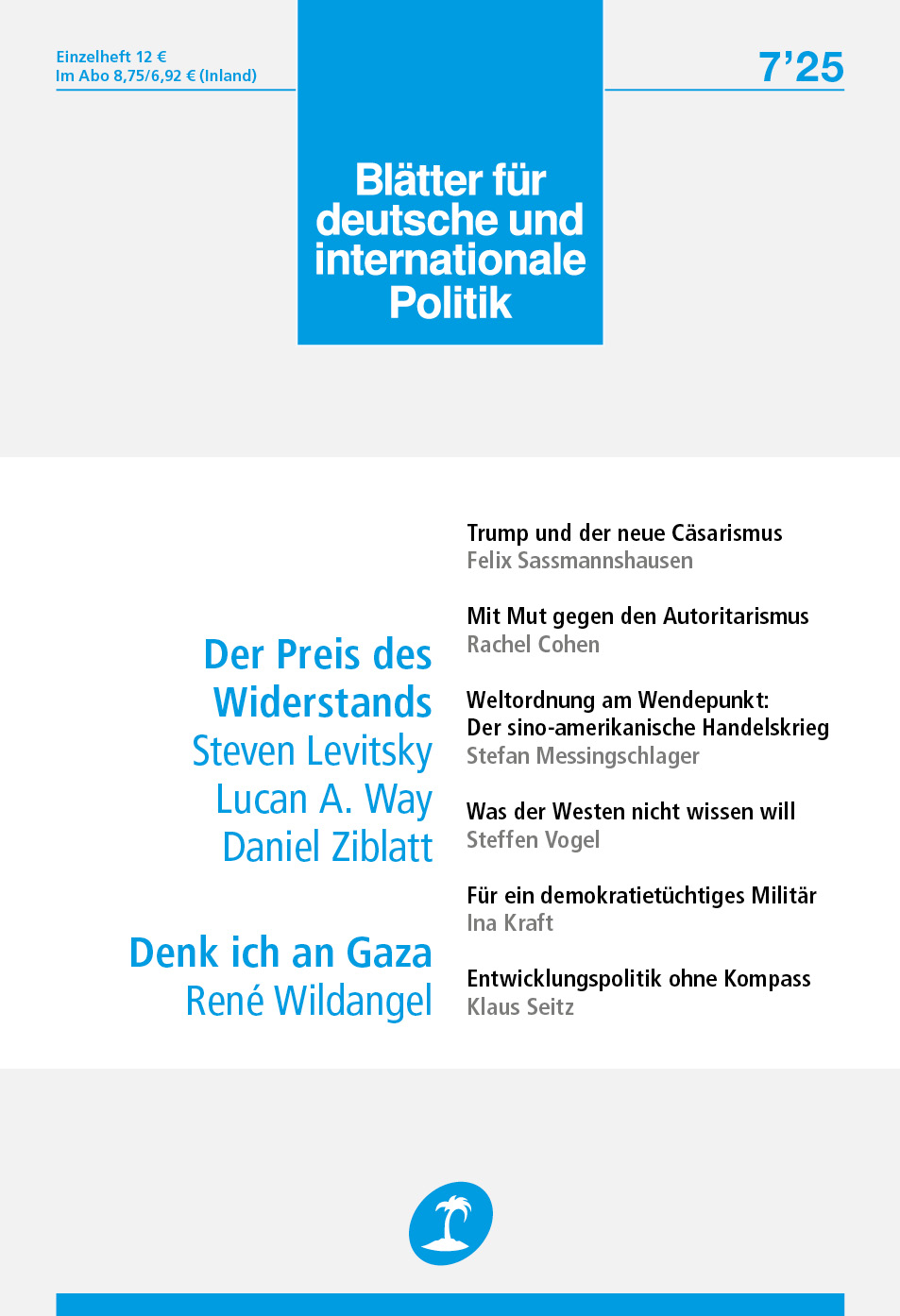Bild: Sollen die Alten nicht verarmen, wird ein wachsender Teil des Volkseinkommens für die Rente aufgewandt werden müssen (IMAGO / YAY Images)
Aufgrund der demografischen Entwicklung in Deutschland droht der gesetzlichen Rentenversicherung ein Finanzierungsproblem. Die schwarz-rote Koalition will dieses unter anderem durch die Aktiv- und die Frühstartrente entschärfen. Doch die Pläne der Regierung seien weder nachhaltig noch gerecht, so Frank Hoffer. Er zeigt Wege auf, wie sich das Rentensystem langfristig finanzieren und gerechter gestaltet ließe.
Der Anteil der über 67-Jährigen wird zwischen 2025 und 2036 von 20 auf 24 Prozent und damit auf knapp ein Viertel der Bevölkerung steigen. Bis 2070 bleibt er dann weitgehend konstant, um danach leicht zu sinken. Sollen die Alten nicht verarmen, wird ein wachsender Teil des Volkseinkommens für Rentenzahlungen und Pflegeleistungen aufgewandt werden müssen.
Angesichts dieser demografischen Herausforderungen mehren sich die Stimmen, die auf ein Absenken des Rentenniveaus oder eine Erhöhung des Renteneintrittsalters als Gebot der Generationengerechtigkeit drängen. Doch die Gerechtigkeitsdebatte wird damit von einem Ausgleich zwischen Reich und Arm hin zu einem Konflikt zwischen Alt und Jung verschoben.
Auch von der neuen Bundesregierung sind bisher nur begrenzte und letztlich nicht zielführende Reformschritte bekannt, die das System weder gerechter machen noch die Frage beantworten, wie das Beitragsniveau trotz des demografischen Wandels ohne substanzielle Beitragserhöhungen und ohne Erhöhung des Renteneintrittsalters gesichert werden kann. Dem demografischen Wandel will die Groko durch eine freiwillige Anhebung des Renteneintrittsalters Rechnung tragen. Aktivrentner sollen ab Eintritt in das gesetzliche Rentenalter zudem bis zu 2000 Euro monatlich steuer- und abgabenfrei zur Rente dazuverdienen können. Diese Regelung mag geeignet sein, den Fachkräftemangel abzumildern – zur Entlastung der Rentenversicherung trägt sie aber weder auf der Einnahmen- noch auf der Ausgabenseite bei. Sie vermindert allerdings die Einkommenssteuereinnahmen, da Millionen von Arbeitsstunden dann steuerfrei werden.
Die Mütterrente wiederum erhöht die Rente von allen Frauen mit Kindern, die nicht in der Grundsicherung sind. Relativ profitieren davon am meisten die Frauen, deren Rente knapp oberhalb der Grundsicherung liegt. Sie ist eine vergleichsweise teure, steuerfinanzierte Rentenerhöhung mit geringer verteilungspolitischer Wirkung.
Weiterhin soll die von der Union propagierte kapitalgedeckte Frühstartrente kommen. Der Bund soll monatlich für jedes Kind zwischen sechs und 18 Jahren zehn Euro in ein Kapitalmarktdepot einzahlen, das dann bei Eintritt ins Rentenalter verrentet werden kann. Zu diesem Zweck wird der Staat jährlich etwa eine Mrd. Euro an den Kapitalmarkt transferieren, damit bei einer Rendite von sechs Prozent im Jahre 2085 ein Rentenbetrag von 170 Euro ausgezahlt werden kann – das entspräche, den bis dahin zu erwartenden Kaufkraftverlust mit eingerechnet, 50 Euro zu heutigen Preisen. Dies aber ist kein wesentlicher Beitrag zur Finanzierung der Alterssicherung. Hinzu kommt: Bis 2085 trägt die Frühstartrente nicht zur Entlastung der Rentenkasse bei, sondern erfordert zusätzliche Steuerausgaben.
»Bei der Frühstartrente geht es darum, der Finanzindustrie den Markt staatlich geförderter Alterssicherung zu erschließen.«
Bei der Frühstartrente geht es vielmehr darum, der Finanzindustrie den institutionellen Zugang zum lukrativen Markt staatlich geförderter Alterssicherung zu erschließen. Ob allerdings junge Menschen sich nach dem 18. Lebensjahr freiwillig weiter privat versichern wollen, nur weil sie bereits mit 18 Jahren über ein auf weitere 50 Jahre festgelegtes Aktienkapital von rund 2000 Euro verfügen, ist zweifelhaft. Unzweifelhaft dürfte dagegen sein, dass dann der Ruf kommen wird, „private“ Vorsorge verpflichtend zu machen.
Darüber hinaus plant die schwarz-rote Koalition die Integration bisher nicht obligatorisch versicherter Selbstständiger in die gesetzliche Rentenversicherung. Tatsächlich verbessert sich dadurch für die nächsten 30 bis 40 Jahre das Verhältnis von Beitragszahlern zu Rentenbeziehern. Zugleich wird die wachsende Zahl von Soloselbstständigen, die aufgrund prekärer Einkommensverhältnisse oft unterversichert sind, vor Altersarmut geschützt. Keine Entlastung würde dagegen die von Ministerin Bärbel Bas (SPD) ins Gespräch gebrachte Integration der Beamtenversorgung in die gesetzliche Rentenversicherung bringen. Denn für die nächsten 40 bis 50 Jahre müssten dann zusätzlich zu den Beamtenpensionen die Sozialversicherungsbeiträge für neu eingestellte Beamte gezahlt werden. Ausgerechnet während der schwierigsten demografischen Phase in Deutschland bestünde dadurch eine Doppelbelastung der öffentlichen Haushalte. Soweit das vornehmliche Ziel dieses Vorschlags die Kürzung der Beamtenpensionen ist, wäre dies einfacher durch eine gesetzliche Kürzung zukünftiger Pensionen als durch einen Systemwechsel zu bewerkstelligen.
Um trotz des demografischen Wandels angemessene Renten zahlen zu können, muss das Produktivitätswachstum pro Arbeitnehmer gleich oder größer als die Abnahme der Zahl der aktiven Beschäftigten sein. Mit anderen Worten, wenn mit einer kleineren Zahl von Beschäftigten ein gleich großes oder sogar höheres Bruttosozialprodukt erwirtschaftet wird, ist die Finanzierung der Renten kein absolutes, sondern ein Verteilungsproblem. Die Steigerung der Produktivität bei einer alternden Erwerbsbevölkerung ist daher von entscheidender Bedeutung und erfordert vor allem massive Investitionen in Ausbildung, lebenslanges Lernen, Forschung und Entwicklung sowie innovationsfreundliche Rahmenbedingungen.
Ob dagegen die erforderlichen Mittel über Rentenversicherungsbeiträge wie beim Umlageverfahren oder über die immer wieder angedachten Aktienrenten aufgebracht werden, ist im Sinne der generativen Belastung egal. In Deutschland hat sich mit der großen Rentenreform von 1957 das Umlageverfahren durchgesetzt, nicht zuletzt, weil nach beiden Weltkriegen das angesparte Kapital der Rentenversicherung jeweils inflationsbedingt vollständig vernichtet worden war und nur über ein Umlageverfahren überhaupt eine Dynamisierung der Renten finanzierbar war. Unabhängig von der Finanzierungsart müssen die Rentenzahlungen jedoch immer in der Periode erwirtschaftet werden, in der sie verausgabt werden.
»Ein exzellentes Bildungssystem, eine moderne Infrastruktur und ökologische Technologien sind Gebote der Generationengerechtigkeit.«
Entscheidend ist die Ertragskraft der Volkswirtschaft. Deshalb muss die ältere Generation an die Jüngeren eine hochproduktive und ökologisch lebenswerte Volkswirtschaft weitergeben. Ein exzellentes Bildungssystem, eine moderne Infrastruktur und ökologische Zukunftstechnologien sind absolute Gebote der Generationengerechtigkeit. Dummköpfe auf maroden Straßen werden den Karren nicht aus dem Dreck ziehen.
Das Sondervermögen für Investitionen ist daher eine dringend gebotene Aufhebung der makroökonomischen Selbstfesselung Deutschlands. Haushaltspolitisch systemwidrig ist es allerdings, für Investitionen nur eine einmalige Ausnahme von 500 Mrd. Euro vorzusehen, während für konsumtive Rüstungsausgaben die Schuldenbremse aufgehoben wird. Das Nato-Vorhaben, dass die Mitgliedstaaten neben den unmittelbaren Verteidigungsausgaben auch Investitionen in die verteidigungsrelevante Infrastruktur in Höhe von 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) tätigen sollen, entspricht rund 60 Mrd. Euro im Jahr. Diese zivil-militärischen Ausgaben übersteigen das auf zwölf Jahre angelegte Investitionsprogramm der Bundesregierung um rund 200 Mrd. Euro. Würde das 500-Milliarden-Euro-Programm auch dafür aufgewendet, bliebe kaum noch etwas für generationengerechte Investitionen in Innovation, Bildung, Forschung und ökologische Zukunftssicherung übrig.
Der Verschleiß der Infrastruktur, die Bildungsmisere und ökologische Verantwortungslosigkeit aber sind die schwerwiegendsten Ungerechtigkeiten gegenüber den nachwachsenden Generationen. Sie müssen unter hohen Kosten reparieren, was wir fahrlässig zerstören. Allerdings ist der intergenerative Zusammenhang hier nicht unmittelbar sichtbar. Bei den Rentenzahlungen dagegen finden erkennbar erhebliche Transferleistungen von Jung zu Alt statt.
Die jährlichen Rentenzahlungen der gesetzlichen Rentenversicherung betragen etwa 375 Mrd. Euro. Gleichzeitig schätzt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) die jährlichen Erbschaften und Schenkungen auf etwa 400 Mrd. Euro.[1] Die junge Generation erbt also jährlich etwas mehr, als sie an Rentenleistungen aufbringen muss. Die Alten geben mehr an die Jungen zurück, als sie von ihnen bekommen. Keine nachwachsende Generation wird so viel erben wie die Kinder der Babyboomer. Nicht nur konnten in den vielen Jahrzehnten von Frieden und Wachstum erhebliche Vermögen aufgebaut werden, sondern der wachsenden Zahl Sterbender steht auch eine abnehmende Zahl von Erben gegenüber. Allerdings verteilt sich dieser Transfer sehr ungleich. Die Hälfte wird an die oberen zehn Prozent der nächsten Generation vererbt, während die untere Hälfte fast leer ausgeht.
Durch das bestehende System weitgehend gering besteuerter Erbschaften entsteht eine auf leistungslosem Einkommen basierende Vermögenselite. Dies ist für eine dynamische Marktwirtschaft eine systemwidrige Fehlentwicklung. Eine progressive Erbschaftssteuer von durchschnittlich 20 Prozent zur Finanzierung des demografischen Wandels würde dem Bundeshaushalt 80 Mrd. Euro einbringen und damit die Chancengleichheit innerhalb der jüngeren Generation erhöhen, weil wenige ihren ungerechtfertigten Startvorteil verlören, während viele über geringere Sozialversicherungsleistungen entlastet würden.
»Wer überdurchschnittlich lange eine hohe Rente bezieht, sollte dies nicht von den ärmeren Beitragszahlern bezahlt bekommen.«
Mehr Gerechtigkeit bringen würden auch differenziertere Kriterien für den Einstieg ins Rentenalter. Die Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag eine weitere Anhebung des Renteneintrittsalters bis 2031 ausgeschlossen. Unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten ist eine generelle Verlängerung der Lebensarbeitszeit für alle in der Tat nicht überzeugend, da das Eintrittsalter ins Berufsleben stark variiert und die psychischen und physischen Belastungen sich zwischen verschiedenen Berufsgruppen erheblich unterscheiden. Differenzierte Renteneintrittskriterien statt eines einheitlichen Renteneintrittsalters wären gerechter, aber auch bürokratisch erheblich komplexer. Vergleichsweise einfach ist dagegen die Berücksichtigung der signifikanten Korrelation zwischen höheren Einkommen und höherer Lebenserwartung bei der Berechnung der Renten.
Die Bezieher hoher Renten leben durchschnittlich über fünf Jahre länger als die Bezieher kleinerer Renten. Die Wohlhabenden sind damit die Gewinner im Generationenvertrag. Die Bezieher kleiner Einkommen zahlen dagegen überdurchschnittlich für die Rente der Besserverdiener. Diese Ungerechtigkeit könnte reduziert werden: etwa durch eine Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze um 25 Prozent bei gleichzeitig geringerer Berücksichtigung von Rentenversicherungsbeiträgen oberhalb von 150 Prozent des Medianeinkommens für die Berechnung der Rente. Mit anderen Worten: Die erhöhten Rentenversicherungsbeiträge würden nicht zu entsprechenden Rentenerhöhungen bei den Besserverdienenden führen, sondern als allgemeine Deckungsmittel für Rentenleistungen zur Verfügung stehen und entsprechend den Beitragsanstieg für die übrigen Versicherten dämpfen. Im Sinne echter Äquivalenz zwischen Beiträgen und Leistungen ist die Berücksichtigung der einkommensabhängigen Lebenserwartung ein Gebot der Gerechtigkeit. Wer überdurchschnittlich lange eine hohe Rente bezieht, sollte dies nicht von den ärmeren Beitragszahlern bezahlt bekommen.
In der reichen Bundesrepublik ist die langfristige Finanzierung der Renten eine lösbare Aufgabe. Statt einer starren Altersgrenze sollte das Renteneintrittsalter sowohl die individuellen Erwerbsbiografien als auch die allgemeine Entwicklung der Lebenserwartung berücksichtigen. Durch eine substanzielle Erbschaftssteuer, bei der die Vermögen der sterbenden Rentner zur Finanzierung der Neurentner beitragen, kann der sich demografisch ergebene Anstieg der Beitragslast erheblich abgebremst werden. Die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze und die Berücksichtigung der überdurchschnittlichen Lebenserwartung der Besserverdiener bei der Rentenberechnung führen gleichzeitig zu höheren Beitragseinnahmen und geringeren Rentenkosten. Eine ergänzende moderate Anhebung der Rentenversicherungsbeiträge wäre bei positiver Reallohnentwicklung dann keine übermäßige Belastung der jüngeren Generation mehr. Mindestens genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger, ist allerdings eine vorausschauende Politik, die durch staatliche Investitionen in Bildung, Infrastruktur und die ökologische Transformation sowie eine innovationsfördernde Regulierungs- und Förderpolitik die Voraussetzungen für Produktivitätswachstum und hohes Beschäftigungsniveau schafft.
[1] Kira Baresel u.a., Hälfte aller Erbschaften und Schenkungen geht an die reichsten zehn Prozent aller Begünstigten, in: „DIW Wochenbericht“, 5/2021, S. 63-71.